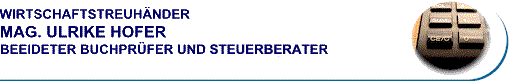
|
|
|
|
News-ArchivDezember 2024Last-Minute Steuertipps
Neben unseren Steuertipps zum Jahresende aus der vorangegangenen Ausgabe der Steuernews finden Sie hier noch einige Last-Minute-Tipps vor dem Jahreswechsel: Geschenke an MitarbeiterFür die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber sind die Geschenke Betriebsausgaben und mindern als solche den Gewinn. Für die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter handelt es sich bei Geschenken SpendenSpenden aus dem Betriebsvermögen sind abzugsfähig, wenn sie an Einrichtungen geleistet werden, die ausdrücklich im Gesetz genannt sind oder die in der Liste des Bundesministeriums für Finanzen aufscheinen (https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden/show_mast.asp, Gültigkeitsende beachten). Zu beachten ist, dass ab 2024 durch das in Kraft treten des Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 die Spendenabsetzbarkeit im Einkommensteuergesetz auf deutlich mehr Organisationen ausgeweitet wurde. Spenden aus dem Betriebsvermögen dürfen 10 % des Gewinns des aktuellen Wirtschaftsjahres vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrages nicht übersteigen. Spenden können als Sonderausgaben bis zur Höhe von maximal 10 % des Gesamtbetrags der Einkünfte des jeweiligen Jahres abgesetzt werden. Dabei sind Spenden aus dem Betriebsvermögen einzurechnen. Ausnahme von der gewerblichen Sozialversicherung (GSVG) für KleinunternehmerKleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer im Sinne des GSVG mit geringen Umsätzen und Einkünften können unter ganz bestimmten Voraussetzungen bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) eine Ausnahme von der Pensions- und Krankenversicherung für das Jahr 2024 bis zum 31.12.2024 beantragen. Die Erfüllung der Voraussetzungen werden im Nachhinein anhand des Umsatz- und Einkommensteuerbescheides überprüft. Wird diese Ausnahme von der Pflichtversicherung beantragt und genehmigt, ist zu beachten, dass aus der gewerblichen Tätigkeit keine Absicherung in der Pensions- und Krankenversicherung besteht. Stand: 26. November 2024 Umfassende Verschärfungen in der Betrugsbekämpfung
Um den gewerblichen Betrug weiter einzudämmen, wurde im Jahr 2024 das Betrugsbekämpfungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz besteht aus zwei Teilen, wobei sich Teil I (in Kraft getreten mit Juli 2024) dem abgabenrechtlichen Betrug widmet und vorwiegend Änderungen im Finanzstrafrecht bewirkt. Teil II (in Kraft getreten mit September 2024) des Gesetzes wurde vom Arbeits- und Wirtschaftsministerium ausgearbeitet und adressiert den gewerblichen Sozialbetrug. Nachfolgend die wesentlichen Highlights. Teil I BetrugsbekämpfungsgesetzAusstellung und Verwendung von Scheinrechnungen Kernstück des neuen Gesetzes ist die Schaffung einer Sanktionsbestimmung (Finanzordnungswidrigkeit), welche auf die Ausstellung und Annahme von Scheinrechnungen abzielt. Strafbar nach dem neuen Tatbestand ist, wer mit Vorsatz für abgaben- oder monopolrechtlich zu führende Bücher oder Aufzeichnungen Belege verfälscht, falsche oder unrichtige Belege herstellt oder verfälschte, falsche oder unrichtige Belege verwendet, um einen Geschäftsvorgang vorzutäuschen oder dessen wahren Gehalt zu verschleiern. Die neu geschaffene Finanzordnungswidrigkeit sieht Geldstrafen bis € 100.000,00 vor. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Änderungen beim Verkürzungszuschlag Abgabenbehörden können unter bestimmten Voraussetzungen bei Nachforderungen einen 10%igen Verkürzungszuschlag festsetzen, wenn begründeter Verdacht eines Finanzvergehens vorliegt. Wird der Zuschlag entrichtet, so tritt Straffreiheit ein. Der Verkürzungszuschlag war bis dato auf jene Fälle beschränkt, bei denen die Abgabennachforderung für ein Jahr € 10.000,00 und in Summe € 33.000,00 nicht überstieg. Im Rahmen der Neuregelung wurde die jährliche Betragsgrenze von € 10.000,00 gestrichen, sodass die Nachforderung nur mehr in Summe € 33.000,00 nicht übersteigen darf. Teil II SozialbetrugsbekämpfungsgesetzAuch im Rahmen des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes kam es zu umfangreichen Änderungen. Stellvertretend hierfür sind die Einbindung des AMS als Kooperationsstelle, die Ausweitung und Erfassung von Tatbeständen in der Sozialbetrugsdatenbank sowie die Erweiterung der Definition des Scheinunternehmens zu nennen. Stand: 26. November 2024 Voraussichtliche Sozialversicherungswerte für 2025
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
Unfallversicherung € 144,84 /Jahr bzw. € 12,07/Monat Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten. Stand: 26. November 2024 Neue BMF-Information für Plattformbetreiber – häufig gestellte Fragen
Mit 1.1.2023 ist in Österreich das Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz (DMPG) in Kraft getreten, welches umfassende Meldepflichten für Plattformbetreiber vorsieht. Das Gesetz sieht vor, dass meldepflichtige Plattformbetreiber personenbezogene Daten und Transaktionen ihrer Anbieter an die Finanzbehörden melden müssen. Dadurch erlangt die Finanzverwaltung leichter Kenntnis über allfällige Umsätze von Anbietern und kann in der Folge nicht versteuerte Einkünfte leichter aufdecken. Einer Meldepflicht durch den Plattformbetreiber unterliegen nachfolgende Transaktionen:
Aufgrund der mit dem Gesetz einhergehenden Unklarheiten hat das BMF nunmehr häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz zusammengefasst und in einem Frage-Antwort-Katalog in der Findok veröffentlicht. Das Dokument kann unter nachfolgendem Link abgerufen werden: https://findok.bmf.gv.at/findok/iwg/82/82976/82976.1.pdf Meldepflicht bis Ende Jänner 2025Da meldepflichtige Plattformbetreiber relevante personenbezogene Daten und Transaktionen ihrer Anbieter bis Ende Jänner des Folgejahres (für 2024 somit bis Ende Jänner 2025) melden müssen, empfiehlt es sich, bereits jetzt, zeitnah etwaige strittige Fragen diesbezüglich abzuklären. Stand: 26. November 2024 Verlängerung eines Bestandsvertrages = erneute Gebührenpflicht?
Während die Vermietung von Wohnraum gänzlich von der Gebührenpflicht befreit ist, unterliegen andere Bestandsverträge wie Miet- oder Pachtverträge (z. B. Vermietung von Geschäftsräumen) entsprechend den Bestimmungen des Gebührengesetzes einer Rechtsgeschäftsgebühr im Ausmaß von 1 % (ausgenommen Jagdpacht mit 2 %). Die Gebühr bestimmt sich nach der Dauer des Vertragsverhältnisses. Wird das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, so ist die Bemessungsgrundlage mit dem dreifachen Jahreswert der wiederkehrenden Leistung beschränkt. Bei einem Vertrag auf bestimmte Zeit ist grundsätzlich die vereinbarte bestimmte Dauer für die Berechnung der Gebühr heranzuziehen (maximal jedoch der achtzehnfache Jahreswert). Wird ein Bestandsvertrag zwar befristet abgeschlossen, kann dieser allerdings vorzeitig mittels Kündigung aufgelöst werden, ist für Zwecke des Gebührenrechts von einem Vertrag von unbestimmter Dauer auszugehen. Strittig war bis dato die Frage, ob die Verlängerung eines befristeten, aber gebührenrechtlich für unbestimmte Zeit qualifizierten Bestandsvertrages eine erneute Gebührenpflicht auslöst. Rechtsansicht des VwGHDer VwGH verweist im Rahmen seiner Entscheidung (VwGH v. 10.4.2024, Ro 2022/16/0017) auf das Gebührengesetz, worin geregelt ist, dass die Verlängerung der Geltungsdauer eines Vertrages als selbständiges Rechtsgeschäft eine erneute Gebührenpflicht auslöst. Der Umstand, dass bereits das „ursprüngliche“ Rechtsgeschäft vor Verlängerung für gebührenrechtliche Zwecke auf unbestimmte Zeit abgeschlossen gilt, ändert an dieser Rechtsauffassung nichts, da die Verlängerung selbst wie ein neues (losgelöstes) Rechtsgeschäft zu bewerten ist. Stand: 26. November 2024 Was ist der Partnerschaftsbonus?
Elternpaare, welche die Kinderbetreuung im annähernd gleichen Ausmaß übernehmen, werden im Rahmen des Partnerschaftsbonus hierfür mit € 1.000,00 belohnt. VoraussetzungenWird das pauschale oder das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld von beiden Elternteilen zu annähernd gleichen Teilen (50:50 bis 60:40) und mindestens im Ausmaß von je 124 Tagen bezogen, so kann jeder Elternteil nach Ablauf der höchstmöglichen Gesamt-Anspruchsdauer eine Auszahlung des Partnerschaftsbonus beantragen. Dieser wird je Elternteil als Einmalzahlung in Höhe von € 500,00 geleistet (in Summe für beide Elternteile somit € 1.000,00). AntragstellungDer Partnerschaftsbonus ist von jedem Elternteil gesondert beim jeweiligen Krankenversicherungsträger zu beantragen, welcher die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes vornimmt. Die Antragstellung hat entweder gleich mit der Antragstellung auf das Kinderbetreuungsgeld oder spätestens innerhalb von 124 Tagen (ca. 4 Monate) ab dem letzten möglichen Bezugstag des insgesamt letzten Bezugsteiles des Kinderbetreuungsgeldes zu erfolgen. RückforderungEine Rückforderung von zu Unrecht bezogenem Kinderbetreuungsgeld bei einem oder beiden Elternteilen löst zugleich eine Rückforderung beider Partnerschaftsboni aus, sofern dadurch die geforderte Bezugsdauer (mindestens 124 Tage pro Elternteil) oder die vorgeschriebene Aufteilungsquote (50:50 bis 60:40) nicht mehr erreicht wird. Stand: 26. November 2024 Tipps für den erholsamen Weihnachtsurlaub für Unternehmerinnen und Unternehmer
Möchte man als Unternehmerin oder Unternehmer die kommenden Feiertage nutzen und vielleicht auch einmal einen längeren Urlaub antreten, während der Betrieb weiterläuft, sind bestimmte vorbereitende Maßnahmen empfehlenswert. Sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen den Feiertagen auf Urlaub, erwägen Sie einen generellen Betriebsurlaub (allenfalls mit einem eingerichteten Journaldienst). Läuft der Betrieb weiter, suchen Sie sich, wenn möglich, für die Zeit Ihres Urlaubes eine Stellvertretung und klären Sie mit dieser Person Aufgaben, Vollmachten, Notfallkontaktaufnahme, Datenzugriffe und Handlungsspielräume. Planen Sie jene Aufgaben, von denen Sie bereits wissen, dass diese während Ihres Urlaubes zur Erledigung anstehen. Verteilen Sie die Erledigung samt aller notwendigen Informationen auf Ihre Mitarbeiter. Informieren Sie rechtzeitig Ihre Mitarbeiter und aber auch bestimmte Geschäftspartner wie z. B. wichtige Kunden, mit denen Sie persönlich laufend in Kontakt stehen, über Ihre Abwesenheit. In einer automatisierten Antwort auf eingehende E-Mails informieren Sie kurz über Ihre Abwesenheit (mit Angabe des Rückkehrdatums), geben die Kontaktdaten Ihrer Stellvertretung bekannt und dass Sie sich nach Ihrem Urlaub auch gerne wieder persönlich um das Anliegen kümmern werden. Überlegen Sie sich genau im Vorhinein, ob und wie Sie im Urlaub erreichbar sein wollen. Stand: 26. November 2024 November 2024Steuertipps zum Jahresende 2024
Vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbelastung bei jedem sehr groß. Vieles muss unbedingt noch vor dem 31.12. erledigt werden (für Bilanzierende gilt dies meist, wenn sich das Wirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr deckt). Trotzdem sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, um seine Steuersituation nochmals zu überdenken. Hier eine (unvollständige) Auswahl von einigen Steuertipps zum Jahresende: 1. Gewinnfreibetrag bei Einzelunternehmen und betrieblicher MitunternehmerschaftDer Gewinnfreibetrag besteht aus zwei Teilfreibeträgen. Das sind der Grundfreibetrag und der investitionsbedingte Freibetrag. Wird nicht investiert, so steht natürlichen Personen (mit betrieblichen Einkünften) für 2024 jedenfalls der Grundfreibetrag in Höhe von 15 % des Gewinns zu, höchstens aber bis zu einem Gewinn in Höhe von € 33.000,00 (maximaler Freibetrag € 4.950,00). Übersteigt der Gewinn € 33.000,00, kann ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag hinzukommen, der davon abhängt, in welchem Umfang der übersteigende Freibetrag durch bestimmte Investitionen im jeweiligen Betrieb gedeckt ist. Dieser beträgt:
Nicht vergessen: Beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag müssen Sie tatsächlich in bestimmte abnutzbare, neue, körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Mindestnutzungsdauer von mindestens vier Jahren investieren – auch begünstigt ist die Investition in bestimmte Wertpapiere. Für Wirtschaftsgüter, die zur Deckung des Gewinnfreibetrages herangezogen werden, kann kein IFB geltend gemacht werden. 2. Erwerb von geringwertigen WirtschaftsgüternWirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 1.000,00 können im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. Daher sollten Sie diese noch bis zum Jahresende anschaffen, wenn eine Anschaffung für (Anfang) 2025 ohnehin geplant ist. Hinweis: Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern ist die Verausgabung maßgeblich. 3. Halbjahresabschreibung für kurz vor Jahresende getätigte InvestitionenEine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann erst ab Inbetriebnahme des jeweiligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht werden. Erfolgt die Inbetriebnahme des neu angeschafften Wirtschaftsgutes noch kurzfristig bis zum 31.12.2024, steht eine Halbjahres-AfA zu. 4. Beschleunigte Abschreibung bei GebäudenFür Gebäude, die nach dem 30.6.2020 angeschafft oder hergestellt worden sind, kann unter bestimmten Voraussetzungen im ersten Jahr die Abschreibung höchstens das Dreifache des bisher gültigen Prozentsatzes, im Folgejahr höchstens das Zweifache betragen. Die Halbjahresabschreibungsregelung ist dabei nicht anzuwenden, sodass auch bei Anschaffung, Herstellung oder Einlage im zweiten Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag aufwandswirksam ist. Die AfA beträgt für 2024 – 2026 fertiggestellte Wohngebäude auch in den beiden der erstmaligen Berücksichtigung nachfolgenden Jahren höchstens das Dreifache des gesetzlichen Prozentsatzes (1,5 %). Dies gilt nur für Wohngebäude, die zumindest dem „Gebäudestandard Bronze“ nach dem auf der entsprechenden OIB-Richtlinie basierenden „klimaaktiv Kriterienkatalog in der aktuellen Version 2020“ des Umweltministeriums entsprechen. 5. InvestitionsfreibetragBei der Anschaffung oder Herstellung von bestimmten Wirtschaftsgütern des abnutzbaren Anlagevermögens kann zusätzlich zur Abschreibung ein Investitionsfreibetrag (IFB) in Höhe von 10 % bzw. 15 % der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten als Betriebsausgabe unter Beachtung einer Reihe von Voraussetzungen geltend gemacht werden. Unter anderem ist eine Behaltefrist von vier Jahren zu beachten. Auch sind bestimmte Wirtschaftsgüter vom IFB ausgeschlossen, wie insbesondere jene, die zur Deckung des Gewinnfreibetrages herangezogen wurden. Der IFB kann auch von Kapitalgesellschaften geltend gemacht werden. 6. Steuerstundung (Zinsgewinn) durch Gewinnverlagerung bei BilanzierernEine Gewinnverschiebung in das Folgejahr bringt immerhin einen Zinsgewinn durch Steuerstundung. Im Jahresabschluss (bei bilanzierenden Unternehmen) sind unfertige Erzeugnisse (Halbfabrikate), Fertigerzeugnisse und noch nicht abrechenbare Leistungen (halbfertige Arbeiten) grundsätzlich nur mit den bisher angefallenen Kosten zu aktivieren. Die Gewinnspanne wird erst mit der Auslieferung des Fertigerzeugnisses bzw. mit der Fertigstellung der Arbeit realisiert. (Anzahlungen werden nicht ertragswirksam eingebucht, sondern lediglich als Passivposten.) Daher: Die Auslieferung des Fertigerzeugnisses – wenn möglich – mit Abnehmern für den Jahresbeginn 2025 vereinbaren. Arbeiten sollten erst mit Beginn 2025 fertig gestellt werden. Die Fertigstellung muss für das Finanzamt dokumentiert werden. 7. Glättung der Progression bzw. Gewinnverlagerung bei Einnahmen-Ausgaben-RechnernBei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt (mit Ausnahmen) das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Dabei ist darauf zu achten, dass grundsätzlich nur Zahlungen ergebniswirksam sind (den Gewinn verändern) und nicht der Zeitpunkt des Entstehens der Forderung oder Verbindlichkeit, wie dies bei der doppelten Buchhaltung (= Bilanzierung) der Fall ist. Beim Zufluss-Abfluss-Prinzip sind insbesondere für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben die Regelungen zur fünfzehntägigen Zurechnungsfrist zu beachten. 8. ForschungsprämieEs kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Forschungsprämie pro Jahr in Höhe von 14 % der Forschungsaufwendungen geltend gemacht werden (soweit nicht durch steuerfreie Förderungen gedeckt). 9. Letztmalige Möglichkeit der Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2019Mit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-Frist für die Antragstellung der Arbeitnehmerveranlagung 2019 aus. 10. MitarbeiterprämieGewährt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber eine Mitarbeiterprämie bis zu € 3.000,00 auf Basis einer Vorschrift in einem Kollektivvertrag (oder ähnlichem), so ist dies in 2024 unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. 11. RegistrierkasseBei Verwendung einer Registrierkasse ist mit Ende des Kalenderjahres (auch bei abweichenden Wirtschaftsjahren) ein signierter Jahresbeleg (Monatsbeleg vom Dezember) auszudrucken, zu prüfen und aufzubewahren. Die Überprüfung des signierten Jahresbeleges ist verpflichtend (lt. BMF-Info bis spätestens 15. Februar des Folgejahres) und kann manuell mit der BMF- Belegcheck-App oder automatisiert durch Ihre Registrierkasse durchgeführt werden. Zumindest quartalsweise ist das vollständige Datenerfassungsprotokoll extern zu speichern und aufzubewahren. Stand: 02. November 2024 Neuer Rahmen-KV im Hotel- und Gastgewerbe
Mit 1.11.2024 ist der neue Rahmen-KV für Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe in Kraft getreten, welcher unter anderem nachfolgende Änderungen vorsieht: Arbeitszeit
Beschäftigung von Jugendlichen und Lehrlingen
Nachtarbeitszuschlag
Freie Sonntage
Probemonat
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Neuregelung der Lohngruppe 4 ab 1.5.2025
Lohnabschluss
Stand: 02. November 2024 Finanznavi ist online
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und die Österreichische Nationalbank (OeNB) haben mit dem „Finanznavi“ ein neues Online-Finanzbildungsportal präsentiert, welches der breiten Bevölkerung eine Orientierungshilfe bei finanziellen und steuerrechtlichen Fragen bieten soll. InhalteAuf dem Portal finden sich zahlreiche Inhalte zu den Themen Wirtschaft, sicherer Umgang mit Geld, Bezahlmöglichkeiten, Sparen und Investieren, Risikomanagement, Kredite und Schulden sowie zum Bereich Konsumentenschutz. Neben grundlegenden Informationen zu diesen Themenbereichen gibt es auf dem Finanznavi auch zahlreiche Erklärvideos sowie zwei Wissenstests zu diesen Bereichen. Außerdem sind auf dem Portal alle Bildungsangebote, die unter dem Dach der nationalen Finanzbildungsstrategie laufen, abrufbar. Dazu gehören auch die Verbraucher- und Finanzbildungsangebote des Sozialministeriums. Sie erreichen das Finanznavi unter finanznavi.gv.at. Stand: 02. November 2024 Deutschland: E-Rechnungspflicht für B2B-Umsätze startet
Im Zuge der Initiative „VAT in the Digital Age“ (ViDA) der EU-Kommission soll auch eine verpflichtende elektronische Rechnungsausstellung normiert werden. Die unionsweite Regelung wurde aber bisher noch nicht beschlossen. In den einzelnen Mitgliedstaaten gibt es unterschiedliche Regelungen zur E-Rechnung. Ab 1.1.2025 beginnt nun in Deutschland die E-Rechnungspflicht. Unter E-Rechnung versteht man ein strukturiertes elektronisches Format. Eine per E-Mail versandte PDF-Rechnung gilt ab 2025 in Deutschland nicht mehr als elektronische Rechnung. Die E-Rechnung wird verpflichtend für in Deutschland steuerbare B2B-Umsätze (Business to Business) zwischen in Deutschland ansässigen Unternehmen. Ab 1.1.2025 sind Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland zur Annahme einer E-Rechnung verpflichtet. Bis 31.12.2026 können in einer Testphase B2B Inlandsumsätze auch mit „sonstigen Rechnungen“ (Nicht-E-Rechnungen) abgerechnet werden. Bis 31.12.2027 verlängert sich die Testphase für Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu € 800.000,00. Ausländische Unternehmen, die in Deutschland eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte haben, gelten mit jenen Umsätzen, die dieser Betriebsstätte zuzurechnen sind, als in Deutschland ansässig. Insbesondere größere deutsche Unternehmen könnten auch ihre österreichischen Lieferanten darauf drängen, E-Rechnungen in strukturierter Form zu übermitteln. Stand: 02. November 2024 Oktober 2024Steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe
Das BMF hat mit 18. 09. 2024 einen steuerlichen Maßnahmenkatalog im Zusammenhang mit der aktuellen Hochwasserkatastrophe in der Findok veröffentlicht, welcher nachfolgende steuerliche Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene vorsieht: Verlängerung von Fristen:Abgabepflichtige, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind, können einen begründeten Antrag auf Verlängerung der Einreichfrist für eine Abgabenerklärung und einen Antrag auf Verlängerung einer Beschwerdefrist stellen. Zudem kann bei Säumnis einer Frist oder Versäumung einer mündlichen Verhandlung ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden. Erleichterungen bei Steuer(voraus)zahlungen:Abgabenpflichtige, welche von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind, können nachfolgende Anträge stellen:
Steuerfreiheit von Zahlungen beim Empfänger:Bei Opfern von Naturkatastrophen ist Hilfsbedürftigkeit unabhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation anzunehmen. Empfangene Leistungen aus dem Katastrophenfonds sind daher steuerfrei. Dies gilt auch für entsprechende Leistungen von gemeinnützigen oder mildtätigen Privatstiftungen. Ebenfalls sind freiwillige Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden der Hochwasserkatastrophe von der Einkommen- bzw. der Lohnsteuer befreit. Beispiele für derartige freiwillige Zuwendungen sind Geld, geldwerte Vorteile, wie z. B. ein zinsenloses Darlehen des Arbeitgebenden an den Arbeitnehmenden, oder eine Spende an einen betroffenen Haushalt. Freiwilligenpauschale:Für Personen, die ehrenamtlich für eine gemeinnützige Organisation im Bereich der Katastrophenprävention und -hilfe tätig sind, kann ein Freiwilligenpauschale i. H. v. bis zu € 50 pro Tag (höchstens € 3.000 pro Jahr) steuerfrei gezahlt werden. Zuwendungen und Spenden:Getätigte Spenden sind beim Spendenden als Betriebs- oder Sonderausgabe nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn diese für einen begünstigten Zweck (wie Hilfestellung bei Hochwasserschäden) und an eine begünstigte Einrichtung geleistet wurden. Die begünstigten Einrichtungen sind auf der Webseite des BMF gelistet, wie etwa Freiwillige Feuerwehren und verschiedene Hilfsorganisationen. Direkte Spenden an Betroffene können somit nicht steuerlich geltend gemacht werden. Wichtig ist auch, dass bei Spenden aus dem Privatvermögen nur Geldspenden absetzbar sind, während bei Unternehmen auch Sachspenden steuerlich abzugsfähig sind. Im unternehmerischen Bereich sind Geld- und Sachspenden an spendenbegünstigte Einrichtungen bis zu einem Ausmaß von 10 % des Gewinnes eines Betriebes als Betriebsausgabe abzugsfähig. Im privaten Bereich ist die steuerliche Abzugsfähigkeit von Geldspenden mit 10 % des Gesamtbetrages der Einkünfte gedeckelt. Keine Beschränkung der Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe für Hilfsleistungen besteht im unternehmerischen Bereich zudem, wenn diese eine Werbewirksamkeit aufweisen. Für die Abzugsfähigkeit von werbewirksamen "Katastrophenspenden" ist es gleichgültig, wer die Empfänger sind (z.B. Hilfsorganisationen, Gemeinden, eigene Arbeitnehmer). Allgemeine ertragsteuerliche Begünstigungen:Bei der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des abnutzbaren Anlagevermögens mit einer Mindestnutzungsdauer von vier Jahren kann – zusätzlich zur (linearen oder degressiven) Absetzung für Abnutzung – ein Investitionsfreibetrag (IFB) als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Alternativ zum Investitionsfreibetrag kann auch ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag (GFB) für begünstigte Wirtschaftsgüter als Betriebsausgabe in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Ersatzbeschaffungen. Im Falle eines hochwasserbedingten Ausscheidens eines Wirtschaftsgutes vor Ende der vierjährigen Mindestnutzungsdauer unterbleibt eine Nachversteuerung eines geltend gemachten Investitionsfreibetrages und investitionsbedingten Gewinnfreibetrages. Liebhaberei - Hochwasser als Unwägbarkeit:Kommt es infolge der Hochwasserkatastrophe zu unvorhersehbaren Aufwendungen oder Einnahmenausfällen, die ein Ausbleiben des Gesamterfolges bewirken, führen diese Umstände allein nicht zu einer Qualifizierung einer Betätigung als Liebhaberei. Außergewöhnliche Belastungen i. Z. m. Hochwasserschäden:Nachfolgende Kosten, die bei der Beseitigung von Katastrophenschäden anfallen, sind ohne Selbstbehalt als außergewöhnliche Belastung steuerlich abzugsfähig:
Für die steuerliche Berücksichtigung der getätigten Aufwendungen ist erforderlich, dass dem zuständigen Finanzamt die von den Gemeindekommissionen über die Schadenserhebung aufgenommenen Niederschriften sowie die vorliegenden Rechnungen dazu vorgelegt werden. Sollte (ausnahmsweise) eine solche Niederschrift nicht oder nicht vollständig aufgenommen worden sein (z. B. wegen Lage eines Gebäudes in einem als hochwassergefährdet eingestuften Gebiet), muss eine „Selbsterklärung" unter Anschluss der entsprechenden Rechnungen beigebracht werden. Wird zur Finanzierung der hochwasserbedingten Kosten ein Darlehen aufgenommen, so können die anfallenden Darlehensrückzahlungen samt Zinsen als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Freibetragsbescheid:Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können für die (voraussichtlich) anfallenden, durch Katastrophenschäden verursachten Ausgaben, die nach den dargestellten Kriterien eine außergewöhnliche Belastung darstellen, bis 31. Oktober beim Finanzamt die Ausstellung eines gesonderten Freibetragsbescheides beantragen. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kann bei rechtzeitiger Vorlage den Freibetrag rückwirkend (durch Aufrollung früherer Lohnabrechnungen) für das gesamte Jahr 2024 berücksichtigen. Befreiung von Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben:Für bestimmte Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben besteht eine Befreiung im Zusammenhang mit Katastrophen wie Hochwasserschäden. Diesbezüglich ist auf die Information des BMF zu verweisen (siehe Link weiter unten). Abstandnahme von der Festsetzung der Grunderwerbsteuer:Von der Festsetzung der Grunderwerbsteuer kann ganz oder teilweise Abstand genommen werden, wenn in Folge der Hochwasserkatastrophe ein der Grunderwerbsteuer unterliegender Tatbestand (z. B. Kauf Ersatzgrundstück) gesetzt werden muss. Vollständige BMF-Information (abrufbar unter): Stand: 25. September 2024 ePrämie für eingespartes CO2 nutzen
Um den Anteil von Elektroautos im Straßenbild zu erhöhen, wurden in Österreich viele steuerliche Anreize wie der fehlende Sachbezug oder die Berechtigung zum vollen oder teilweisen (mit Eigenverbrauchsanteil) Vorsteuerabzug geschaffen. Mit der im Jahr 2023 eingeführten ePrämie können Halterinnen und Halter von Elektroautos weiter vom Betrieb dieser Fahrzeuge profitieren. So funktioniert'sDie ePrämie basiert auf dem Konzept der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote), welche das Ziel verfolgt, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Halter eines Elektroautos können den für ihr Fahrzeug an nicht öffentlichen Ladestationen (z. B. Privatgarage oder Firmenladestation) bezogenen Strom einmal pro Jahr an einen THG-Quotenhändler übertragen und erhalten dafür eine Prämie für nicht genutztes CO2. Die bzw. der THG-Quotenhandelnde sammelt in der Folge die eingemeldeten Strommengen und reicht diese beim Umweltbundesamt zur Anerkennung ein. Die Höhe der ePrämie ist abhängig von der Menge des eingemeldeten Stromverbrauchs sowie den Preisen und Verrechnungsmodellen der Anbieter, wobei die daraus lukrierte Prämie mitunter bis zu € 1.000,00 betragen kann. Kann die geladene Strommenge nicht nachgewiesen werden, so kann eine pauschalierte Strommenge von 1.500 kWh pro Jahr beantragt werden. Die ePrämie kann grundsätzlich bis Ende Jänner des Folgejahres beantragt werden, wobei einzelne Händler mitunter kürzere Fristen setzen. Steuerliche BehandlungFür private Halter ist die bezogene ePrämie steuerfrei. Im unternehmerischen Bereich ist diese als Betriebseinnahme zu versteuern. Für weitere Informationen zur ePrämie und deren Abwicklung ist auf die Seite des Umweltbundesamts zu verweisen, welche unter nachfolgendem Link erreichbar ist: www.umweltbundesamt.at/elna/anrechnung-erneuerbarer-strom/e-fahrzeug-besitzerin. Stand: 25. September 2024 Können virtuelle Geschäftsanteile in steuerbegünstigte Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen übergeführt werden?
Virtuelle Gesellschaftsanteile (sogenannte „phantom shares“) haben in den letzten Jahren als Form der Mitarbeiterbeteiligung an Bedeutung gewonnen. Diese Form der Mitarbeiterbeteiligung wurde insbesondere auch bei Start-up-Unternehmen eingesetzt. Die virtuellen Gesellschaftsanteile basieren auf einer schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und den Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern. Im Hinblick auf den Gewinn sind Arbeitnehmer mit virtuellen Anteilen aus wirtschaftlicher Sicht den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern gleichgestellt und erwerben auf Grundlage des bloß fiktiven Gesellschaftsanteils einen schuldrechtlichen Anspruch auf Teilhabe am Gewinn, der steuerlich als Prämie zu qualifizieren ist. Allerdings erhalten die Arbeitnehmer keine Gesellschafterstellung oder die dazugehörigen Gesellschafterrechte. Wie bereits berichtet, ist nun seit 1.1.2024 ein eigenes steuerliches Modell für Mitarbeiterbeteiligungen bei Start-ups und jungen KMU in Kraft. Dabei kann unter bestimmten Voraussetzungen, ein Besteuerungsaufschub bis zur tatsächlichen Veräußerung der Anteile gewährt werden und es wird die Komplexität der Bewertung des geldwerten Vorteils durch eine Pauschalregelung vermindert. Wenn nun Arbeitnehmer mit virtuellen Anteilen von Start-ups diese neue Regelung in Anspruch nehmen wollen und aus diesem Grund statt der virtuellen Anteile unter die Neuregelung fallende Kapitalanteile (z. B. GmbH-Anteile, Unternehmenswertanteile oder vergleichbare Genussrechte) erhalten, müsste eine Bewertung und Versteuerung des geldwerten Vorteils aus der dadurch stattfindenden Einlösung der virtuellen Gesellschaftsanteile erfolgen. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2024 wurde nun folgende Übergangsregelung normiert: Erhält der Arbeitnehmer im Zeitraum 1.1.2024 bis 31.12.2025 an Stelle von bestehenden virtuellen Anteilen am Unternehmen des Arbeitgebenden, die bloß einen schuldrechtlichen Anspruch auf Teilhabe am Gewinn bzw. am Unternehmenswert vermitteln, eine Start-up-Mitarbeiterbeteiligung, gilt dies als Abgabe der Anteile gegen eine Gegenleistung bis zur Höhe des Nennwerts und es ist kein geldwerter Vorteil anzusetzen. Dabei müssen die Voraussetzungen für eine Start-up-Mitarbeiterbeteiligung vorliegen. Dieser Artikel gibt nur einige Eckpunkte zu diesem komplexen Thema wieder. Eine individuelle Beratung ist jedenfalls erforderlich. Stand: 25. September 2024 Sachbezug auch bei Mehrfachnutzung eines Parkplatzes?
Besteht für eine Arbeitnehmerin bzw. für einen Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein von ihm für Fahrten zum Arbeitsplatz genutztes Kfz während der Arbeitszeit in parkraumbewirtschafteten Bereichen auf einem von der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber bereitgestellten Abstell- oder Garagenplatz abzustellen, so ist hierfür ein Sachbezug von € 14,53 monatlich anzusetzen. Dieser Betrag ist sowohl bei arbeitnehmereigenen als auch bei arbeitgebereigenen Kfz, für die ein Sachbezug anzusetzen ist, anzuwenden. Nutzung durch mehrere ArbeitnehmerEine individuelle Zuweisung eines Garagen- oder Abstellplatzes an einen konkreten Arbeitnehmer ist für die Begründung eines Sachbezuges nicht erforderlich. Steht ein Parkplatz mehreren Arbeitnehmern ohne eine individuelle Zuordnung zur Verfügung, so ist der Vorteil jedes Arbeitnehmers mit € 14,53 monatlich zu bewerten. Ein Sachbezug ist auch dann anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer den Parkplatz nur gelegentlich oder abwechselnd mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Anspruch nimmt, weil er beispielsweise einen Teil seiner Tätigkeit im Homeoffice verrichtet. Das Recht auf Nutzung der Parkfläche kann z. B. durch Übergabe eines Schlüssels für den Einfahrtsschranken, eine Parkkarte oder durch ein Pickerl, mit dem parkberechtigte Fahrzeuge gekennzeichnet werden, eingeräumt werden. Personen, die nicht zum Parken berechtigt sind bzw. auf die Bereitstellung eines Parkplatzes ausdrücklich verzichten, ist kein Sachbezugswert zuzurechnen, wenn auch tatsächlich nicht geparkt wird. Die Kontrolle hierüber obliegt dem Arbeitgeber. Stand: 25. September 2024 VwGH bestätigt flächenmäßige Begrenzung der Hauptwohnsitzbefreiung
Private Veräußerungsgewinne von Grund und Boden, Gebäuden sowie grundstücksgleichen Rechten unterliegen der Immobilienertragsteuer. Handelt es sich bei dem veräußerten Eigenheim bzw. der Eigentumswohnung allerdings um den Hauptwohnsitz der bzw. des Verkaufenden, so unterbleibt eine Versteuerung, wenn diese bzw. dieser selbst seit der Anschaffung oder Errichtung und bis zur Veräußerung durchgehend für mindestens zwei Jahre darin gewohnt hat und der Hauptwohnsitz aufgegeben wird. Keine Besteuerung erfolgt auch dann, wenn der Verkaufende innerhalb der letzten zehn Jahre (vor der Veräußerung) mindestens fünf Jahre durchgehend in diesem Haus oder dieser Wohnung als "Hauptwohnsitzer" gewohnt hat und der Hauptwohnsitz aufgegeben wird. Flächenmäßige Beschränkung der BefreiungDie Hauptwohnsitzbefreiung stellt zwar grundsätzlich auf das Gebäude ab, umfasst allerdings auch den Grund und Boden (anders als die Herstellerbefreiung), soweit dieser der Nutzung des Eigenheims oder der Eigentumswohnung als Garten oder Nebenfläche dient. Die Einkommensteuerrichtlinien sehen diesbezüglich eine Beschränkung der Anwendung der Hauptwohnsitzbefreiung auf Bauplätze bis 1.000 m² vor. Bei größeren Grundstücken ist der 1.000 m² übersteigende Grundanteil steuerpflichtig. Bestätigung durch den VwGHDer VwGH hat nunmehr in seiner Entscheidung vom 24.4.2024 die flächenmäßige Beschränkung der Hauptwohnsitzbefreiung auf Bauplätze bis 1.000 m² bestätigt. Begründet wird die flächenmäßige Beschränkung der Befreiung damit, dass ein Bauplatz im Ausmaß von 1.000 m² als ausreichend anzusehen ist, zumal Grund und Boden begrenzt sind und Bauplätze mit zunehmender Bebauung tendenziell kleiner werden. Die Lage des Grundstücks (Stadt oder Land) oder dessen Bebauung sind nach Ansicht des VwGH hingegen nicht als relevant zu erachten. Stand: 25. September 2024 Was ändert sich bei Freibetragsbescheiden?
Im Zuge der steuerlichen Arbeitnehmerveranlagung kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer unter anderem Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und bestimmte pauschalierte Freibeträge geltend machen und somit Steuern vom Finanzamt im Nachhinein zurückfordern. Mit dem Veranlagungsbescheid ergeht auch ein sogenannter Freibetragsbescheid für das dem Veranlagungsjahr zweitfolgende Jahr. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kann den ausgewiesenen Freibetrag in der laufenden Lohnverrechnung berücksichtigen und es kommt somit für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer zu einer früheren Steuerersparnis. Der Freibetragsbescheid ist allerdings nur eine vorläufige Maßnahme. Der Arbeitnehmer muss dann in der Veranlagung des betreffenden Jahres die tatsächlichen Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen geltend machen. Freibetragsbescheid künftig nur mehr auf AntragVon den rund 480.000 jährlich erstellten Freibetragsbescheiden werden durchschnittlich bloß rund 4 % dem Arbeitgeber zur Berücksichtigung am Lohnzettel vorgelegt. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2024 wurde nun normiert, dass Freibetragsbescheide nur mehr auf Antrag erlassen werden. Dies gilt erstmals für Freibetragsbescheide, die mit einem Veranlagungsbescheid für das Kalenderjahr 2024 erstellt werden. Stand: 25. September 2024 Was ist eine EORI-Nummer und wer benötigt diese?
EORI steht für „Economic Operators Registration and Identification“ und ist der Nachfolger der Zollnummer im EU-Raum. Die EORI-Nummer dient dabei der eindeutigen Identifizierung von im grenzüberschreitenden Außenhandel tätigen Wirtschaftsbeteiligten gegenüber den Zollbehörden und ist im Rahmen der Kommunikation mit diesen anzuführen. Wer muss eine EORI-Nummer beantragen?
Wie erfolgt die Registrierung?Mit 6.6.2024 wurde der Registrierungsprozess neu gestaltet. Dieser erfolgt nun online über das „Portal Zoll/Customs Decisions Austria“ der österreichischen Zollverwaltung. Bereits bestehende EORI-Registrierungen bleiben weiterhin gültig. Stand: 25. September 2024 Effizientere Meetings durch weniger Teilnehmer?
Oft sind Meetings und Besprechungen zu lange, schlecht organisiert und bringen dem Unternehmen zu wenig Nutzen bzw. kosten Zeit und Geld. Eine Möglichkeit, um Besprechungen effizienter zu gestalten, ist die Anzahl der Teilnehmenden zu reduzieren. Schon bei der Planung eines Meetings sollte genau überlegt werden, welcher Teilnehmende für ein bestimmtes Thema wirklich erforderlich ist. Dabei ist es in einem ersten Schritt notwendig, eine Agenda mit den Themen der Besprechung zu erstellen. Beantworten Sie dann folgende Fragen:
Versenden Sie die Agenda und eine Teilnehmerliste rechtzeitig an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So kann sich jede und jeder auf das Meeting vorbereiten. Legen Sie die Auswahlkriterien für die Teilnehmer am Meeting offen, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Beschreiben Sie die Gründe, warum Sie die Anzahl der Teilnehmer beschränken wollen (z. B. Effizienz des Meetings oder Raumgröße). Obengenanntes gilt auch für Online- oder Hybridmeetings. Ein Onlinemeeting mit vielen Teilnehmern ist ohnedies nur mit großer Gesprächsdisziplin durchführbar. Beachten Sie jedoch, dass all jene Personen über die Besprechungsergebnisse informiert werden, für die die Informationen relevant sind. Stand: 25. September 2024 September 2024Umsatzsteuer: Was ändert sich bei der Kleinunternehmerbefreiung?
Von der Umsatzsteuer befreit sind die Umsätze der Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer, wobei man bei Inanspruchnahme dieser Steuerbefreiung auch einen allfälligen Vorsteuerabzug verliert. Entsprechend der aktuellen Regelung ist ein Kleinunternehmer ein Unternehmer, der im Inland sein Unternehmen betreibt und dessen Umsätze im Veranlagungszeitraum € 35.000,00 (netto) nicht übersteigen. Bei dieser Umsatzgrenze bleiben bestimmte Umsätze, wie jene aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen sowie bestimmte steuerbefreite Umsätze außer Ansatz. Das einmalige Überschreiten der Umsatzgrenze um nicht mehr als 15 % innerhalb eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist unbeachtlich. Nutzt ein Unternehmer die Kleinunternehmerbefreiung, kann er bis zur Rechtskraft des Bescheides gegenüber dem Finanzamt schriftlich erklären, dass er auf die Kleinunternehmerbefreiung verzichtet. Die Erklärung bindet die Unternehmerin bzw. den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist spätestens bis zum Ablauf des ersten Kalendermonates nach Beginn dieses Kalenderjahres zu erklären. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2024 wird diese Bestimmung allerdings ab 2025 geändert. Im Folgenden ein Überblick zu den Eckpunkten der Änderungen:
Kleinunternehmer haben zudem ab 2025 die Möglichkeit der vereinfachten Rechnungsausstellung (entsprechend der Bestimmungen für Kleinbetragsrechnungen) unabhängig vom in der Rechnung ausgewiesenen Betrag. Stand: 27. August 2024 Neue BMF-Information zum suspendierten DBA mit Russland
Das BMF hat mit Mai eine neue Information veröffentlicht, wie mit der Suspendierung des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) durch Russland weiter vorzugehen ist und welcher einheitlichen Auslegung durch Österreich diesbezüglich Folge zu leisten ist. Nicht anwendbare DBA-BestimmungenInfolge der Suspendierung des DBA-Russland finden nachfolgende Bestimmungen im Doppelbesteuerungsabkommen künftig keine Anwendung mehr:
Beseitigung einer DoppelbesteuerungDa die oben angeführten Kernbestimmungen im DBA mit Russland suspendiert sind, fühlt sich auch Österreich nicht an diese gebunden und wendet uneingeschränkt die Regelungen des nationalen österreichischen Rechts auf grenzüberschreitende Sachverhalte im Verhältnis zu Russland an, sodass auch eine daraus resultierende Doppelbesteuerung keinesfalls ausgeschlossen werden kann. Eine sich daraus ergebende Doppelbesteuerung kann infolgedessen nur auf nationaler Ebene in Österreich unter Anwendung von § 48 Abs. 5 BAO im Rahmen eines Entlastungsantrages vermieden werden. Die Einräumung einer solchen Entlastungsmaßnahme steht allerdings im Ermessen des zuständigen Finanzamts, wobei das BMF die Gewährung einer Entlastung vor allem bei sanktionierten Personen und Unternehmen als nicht zweckmäßig erachtet. Stand: 27. August 2024 Kalte Progression: Welche Maßnahmen sind für 2025 geplant?
Das Einkommensteuergesetz sieht vor, dass die steuerliche Mehrbelastung durch die sogenannte kalte Progression jährlich abzugelten ist. Dies erfolgt durch eine automatische Anpassung der Grenzbeträge des Einkommensteuertarifes und vieler Absetzbeträge im Ausmaß von zwei Drittel der Inflationsrate. Für das dritte Drittel sind seitens der Bundesregierung Maßnahmen zu beschließen. Daraus ergeben sich nun insgesamt folgende voraussichtliche Änderungen für 2025 (Eckpunkte):
Sozial- und Familienleistungen wie z. B. die Familienbeihilfe werden ebenso valorisiert. Basis dieser Informationen ist der Vortrag an den Ministerrat. Die Gesetzwerdung der Maßnahmen war bei Drucklegung abzuwarten. Stand: 27. August 2024 Anpassung der Größenklassen im Unternehmensgesetzbuch
Im Unternehmensgesetzbuch (UGB) werden Kapitalgesellschaften anhand der drei Größenkriterien Bilanzsumme, Umsatzerlöse sowie Mitarbeiterzahl in Kleinstkapitalgesellschaften, Kleine, Mittelgroße und Große Kapitalgesellschaften eingeteilt. Durch einen delegierten Rechtsakt der EU-Kommission werden ab dem 1.1.2024 die beiden Größenkriterien Bilanzsumme und Umsatzerlöse um jeweils 25 % angehoben. Dies soll für viele Unternehmen eine Reduktion der Prüfungs- und Berichtspflichten bewirken. Voraussichtliche SchwellenwerteDie Richtlinie der EU-Kommission räumt den Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Anpassung der Schwellenwerte eine Bandbreite ein. Ausgehend von den bisherigen Schwellenwerten des § 221 UGB führt die von der EU-Kommission festgelegte Erhöhung um 25 % zu einer Anpassung der Größenklassen im voraussichtlich nachfolgenden Ausmaß:
AnwendbarkeitDie neuen Schwellenwerte sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1.1.2024 beginnen. Den Mitgliedstaaten wird seitens der EU allerdings das Wahlrecht eingeräumt, die neuen Schwellenwerte bereits für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2023 anzuwenden. Maßgeblich für die Einstufung in die jeweilige Größenklasse ist die Einordnung des Unternehmens in den beiden vorangegangenen Jahren. Die finale Umsetzung der EU-Richtlinie im Rahmen des österreichischen UGB hat durch das Bundesministerium für Justiz zu erfolgen und ist aktuell noch ausständig. Stand: 27. August 2024 Wichtiges für Unternehmer bis zum 30.9.2024
Bis zum 30.9.2024 können Sie die Rückerstattung von Vorsteuerbeträgen für 2023 innerhalb der Europäischen Union via FinanzOnline beantragen. Kapitalgesellschaften (wie z. B. auch GmbH & Co KG’s) müssen grundsätzlich spätestens neun Monate nach dem Bilanzstichtag den Jahresabschluss beim Firmenbuch einreichen. Für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Bilanzstichtag 31.12.2023 ist daher der 30.9.2024 der letzte fristgerechte Abgabetag. Wird die Frist versäumt, so hat das Firmenbuchgericht Zwangsstrafen gegenüber der Gesellschaft und deren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführern) zu verhängen. Für die Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen des laufenden Jahres 2024 kann grundsätzlich noch bis zum 30.9.2024 eine Herabsetzung beantragt werden (ist man von Katastrophenschäden betroffen, so kann unter bestimmten Voraussetzungen ein entsprechender Antrag bis 31.10.2024 gestellt werden). Dies sollte insbesondere geprüft werden, falls der diesjährige Gewinn voraussichtlich niedriger sein wird als der des Vorjahrs. Ab 1.10. beginnt die Anspruchsverzinsung für Einkommen- und Körperschaftsteuernachzahlungen für das Vorjahr zu laufen. Der Zinssatz für Anspruchszinsen beträgt 5,88 % (Stand August 2024). Die Anspruchsverzinsung kann mit einer Anzahlung in Höhe der voraussichtlichen Nachzahlung bis 30.9.2024 vermieden werden. Stand: 27. August 2024 Mit einer Planungsrechnung zu mehr Erfolg im nächsten Jahr!
Als Unternehmerin bzw. Unternehmer möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist – sei es durch den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, das Schaffen und Erhalten von Arbeitsplätzen oder das Erzielen von Gewinnen. Um diese Ziele zu erreichen, ist es wichtig, eine klare und spezifische Strategie zu entwickeln und diese in einem gut strukturierten Plan festzuhalten. Ein solides Budget, unterstützt durch eine betriebswirtschaftliche Planung, ist dabei ein entscheidendes Instrument. Es bietet alle notwendigen Informationen, um die Geschäftsaktivitäten effizient zu steuern und hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. So können Krisen besser bewältigt werden. Eine gründliche betriebswirtschaftliche Planung zeigt, wie sich Ihre geplanten Maßnahmen in den verschiedenen Geschäftsbereichen auf den Gesamterfolg Ihres Unternehmens auswirken. Ein realistisches und nachvollziehbares Budget für das nächste Jahr gibt Ihnen eine solide Grundlage, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wichtige Bestandteile dieser Planung sind unter anderem die Finanzbedarfsplanung, die Gewinn- und Verlustplanung sowie die Bilanzplanung. Weitere wichtige Planungsaspekte umfassen die Umsatzplanung, die Investitionsplanung, die Personalplanung und die Liquiditätsplanung. Stand: 28. August 2024 August 2024Aus Homeoffice wird Telearbeit
Mit 1.1.2025 tritt das neue Telearbeitsgesetz (TelearbG) in Kraft und wird ab dann die bisherigen Bestimmungen zum Homeoffice ersetzen. Das neue Gesetz sieht dabei nachfolgende Kernelemente im sozialversicherungs-, arbeits- und steuerrechtlichen Bereich vor. ArbeitsrechtDurch das neue Telearbeitsgesetz wird künftig Remote-Working nicht mehr auf Tätigkeiten im Homeoffice beschränkt sein, sondern ortsungebunden auch beispielsweise in Coworking-Spaces oder Internet-Cafés möglich sein. Die bisherigen Bestimmungen zur Regelmäßigkeit, zum Abschluss und zur Auflösung der Vereinbarung und zur Bereitstellung der Arbeitsmittel bleiben hingegen unverändert. Zudem bedarf es wie bei bisherigen Homeoffice-Vereinbarungen auch künftig einer Einvernehmlichkeit sowie einer Schriftlichkeit der Vereinbarung. SteuerrechtDie Homeoffice-Pauschale wird künftig in Telearbeitspauschale umbenannt, wobei die Steuerfreiheit der Pauschale weiterhin mit € 3,00 pro Tag bzw. € 300,00 im Jahr gedeckelt ist. Auch kann die Anschaffung von ergonomischem Mobiliar weiterhin als Werbungskosten abgesetzt werden. SozialversicherungsrechtIm Hinblick auf die Unfallversicherung wird künftig zwischen Telearbeit im engeren Sinne und Telearbeit im weiteren Sinne unterschieden. Als Telearbeit im engeren Sinne gelten Tätigkeiten in der Wohnung der bzw. des Versicherten, in der Wohnung einer bzw. eines nahen Angehörigen oder in einem Coworking-Space. Hier gilt der Unfallversicherungsschutz sowohl für die Arbeitsleistung als auch für die Wegstrecke zu diesen Orten. Wege zu weiter entfernten Örtlichkeiten oder zu Örtlichkeiten der Telearbeit im weiteren Sinne sind hingegen nicht vom Unfallversicherungsschutz mitumfasst. DatenschutzAus Sicht des Datenschutzes sollen auch für die Telearbeit die gleichen Bestimmungen wie für die Arbeit im Büro gelten. Stand: 29. Juli 2024 Können Unternehmer Vorsteuern auch pauschal ermitteln?
Das Umsatzsteuergesetz ermöglicht es Unternehmerinnen und Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen die abziehbaren Vorsteuerbeträge auch nach Durchschnittssätzen zu ermitteln. Neben einigen Branchenpauschalierungen, die in entsprechenden Verordnungen geregelt sind, sowie den Besonderheiten der Besteuerungen der Umsätze bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, gibt es auch Regelungen für eine allgemeine Vorsteuerpauschalierung, deren Grundzüge Inhalt dieses Artikels sind. Unternehmer, bei denen die Voraussetzungen für die allgemeine Pauschalierung von Betriebsausgaben des Einkommensteuergesetzes (gemäß § 17 Abs. 2 Z 1 und 2) vorliegen, können die abziehbaren Vorsteuerbeträge mit einem Durchschnittssatz von 1,8 % des Gesamtumsatzes aus Tätigkeiten aus selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb (§ 22 und § 23 EStG) mit Ausnahme der Umsätze aus Hilfsgeschäften, höchstens jedoch mit einer abziehbaren Vorsteuer von € 3.960,00, berechnen. Zusätzlich können z. B. folgende Vorsteuerbeträge geltend gemacht werden:
Erklärt man gegenüber dem Finanzamt, dass die Vorsteuerbeträge nach Durchschnittssätzen ermittelt werden, bindet dies den Unternehmer für mindestens zwei Kalenderjahre. Sollen nach einem Widerruf (Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres) die Vorsteuerbeträge nach den allgemeinen Vorschriften ermittelt werden, ist eine erneute Ermittlung des Vorsteuerabzuges nach Durchschnittssätzen frühestens nach Ablauf von fünf Kalenderjahren zulässig. Stand: 29. Juli 2024 Was ist der Unterhaltsabsetzbetrag?
Der Unterhaltsabsetzbetrag stellt eine steuerliche Entlastung für Eltern dar, die gesetzlich zur Zahlung von Unterhalt für ihre Kinder verpflichtet sind. Als Absetzbetrag reduziert er direkt die Einkommensteuerlast. Um den Unterhaltsabsetzbetrag in Anspruch nehmen zu können, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Der Unterhaltsabsetzbetrag steht z. B. nur zu, wenn das Kind nicht dem Haushalt des Steuerpflichtigen zugehört und weder ihm noch seinem von ihm nicht dauernd getrenntlebenden (Ehe-)Partner Familienbeihilfe für das Kind gewährt wird. Das Kind muss sich ständig in Österreich, im EU-/EWR-Raum oder in der Schweiz aufhalten. Neben dem Nachweis des gesetzlichen Unterhalts ist es auch wichtig, dass der Unterhalt tatsächlich und regelmäßig geleistet wird. Die Höhe des Unterhaltsabsetzbetrags ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder, für die Unterhalt geleistet wird. Im Jahr 2024 beträgt der Absetzbetrag pro Monat:
Beispiel: Steht der Unterhaltsabsetzbetrag ganzjährig für zwei Kinder zu, kann 2024 ein jährlicher Absetzbetrag von € 1.044,00 (€ 35,00 + € 52,00 = € 87,00 pro Monat x 12 Monate) geltend gemacht werden. Der Unterhaltsabsetzbetrag wird nicht automatisch gewährt, sondern muss im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung (Jahresausgleich) oder der Einkommensteuererklärung beantragt werden. Weitere Voraussetzungen und Regelungen zum Unterhaltsabsetzbetrag können individuell relevant sein und nur in einer persönlichen Beratung geklärt werden. Stand: 29. Juli 2024 Vorsteuern in einem anderen EU-Land: Wie erfolgt die Erstattung?
Eine österreichische Unternehmerin bzw. ein österreichischer Unternehmer kann sich unter bestimmten Voraussetzungen Vorsteuern, die in einem anderen EU-Land angefallen sind, über das sogenannte EU-Vorsteuervergütungsverfahren erstatten lassen. Zu beachten ist, dass der Unternehmer in dem betreffenden EU-Land keine steuerpflichtigen Umsätze ausgeführt haben darf (außer bestimmten Leistungen wie beispielsweise Beförderungsleistungen oder Reverse-Charge-Umsätze). Der Unternehmer muss den Antrag auf Vorsteuervergütung elektronisch über FinanzOnline bis zum 30. September des Folgejahres, in dem die Vorsteuern angefallen sind, einreichen. Beispiel: Für Vorsteuern, die im Jahr 2023 angefallen sind, muss der Antrag bis zum 30. September 2024 gestellt werden. Der Antrag muss verschiedene Informationen enthalten, darunter:
Diese Informationen können in FinanzOnline erfasst werden (nur ratsam bei wenigen Belegen). Auch Buchhaltungsprogramme bieten oft die Funktionen an, die notwendigen Informationen zu erfassen, eine XML-Datei auszugeben und diese Datei mittels Datenstromverfahren via FinanzOnline an die Finanz zu übermitteln. Je nach EU-Land können unterschiedliche Anforderungen an die Übermittlung von Rechnungen bestehen. Ist der Erstattungszeitraum eines Antrages weniger als ein Kalenderjahr, so darf der Mehrwertsteuerbetrag nicht unter € 400,00 sein. Ist der Erstattungszeitraum ein Kalenderjahr oder den Rest eines Kalenderjahres, darf der Mehrwertsteuerbetrag nicht niedriger sein als € 50,00. Für detaillierte Informationen und landesspezifische Anforderungen ist es empfehlenswert, die entsprechenden Informationen des jeweiligen EU-Landes einzuholen bzw. individuelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Stand: 29. Juli 2024 Investitionen: Wie kann man Steuern sparen?
Das Steuerrecht bietet unterschiedliche Anreize zur Förderung von Investitionen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über einige (Auswahl) wichtige Investitionsbegünstigungen. Gewinnfreibetrag (GFB)Investitionen in bestimmte neue Wirtschaftsgüter ermöglichen es Unternehmerinnen bzw. Unternehmern (natürliche Personen) auch jenen Teil des Gewinnfreibetrages zu nutzen, der von Investitionen abhängt. Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag kann bis zu 13 % jenes Gewinnanteils betragen, der € 33.000,00 übersteigt. Investitionsfreibetrag (IFB)Der IFB ist eine steuerliche Begünstigung für Unternehmen, die in bestimmte neue, abnutzbare, körperliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens investieren. Mit dem IFB können Unternehmen (auch Kapitalgesellschaften) einen Freibetrag von 10 % der Anschaffungskosten geltend machen. Für Investitionen in umweltfreundliche Technologien beträgt der Freibetrag 15 %. Vom IFB und auch vom GFB sind eine Reihe von Wirtschaftsgütern ausgeschlossen. So ist der IFB auch ausgeschlossen für Wirtschaftsgüter, die zur Deckung des GFB herangezogen werden. ForschungsprämieDie Forschungsprämie ist für Unternehmen gedacht, die in Forschung und Entwicklung (F&E) investieren. Sie wird unabhängig davon gewährt, ob das Unternehmen Gewinne erzielt oder nicht. Unternehmen können 14 % ihrer F&E-Aufwendungen als Prämie beantragen, die direkt vom Finanzamt ausgezahlt wird. Weitere InvestitionsbegünstigungenHierunter fällt unter anderem auch der 0 % Umsatzsteuersatz für die Lieferung von bestimmten Photovoltaikanlagen in 2024/25, die Nutzung der degressiven Abschreibung sowie aktuell auch steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Baukonjunktur. Individuelle BeratungFür jede der oben genannten Investitionsbegünstigungen sind eine Reihe von Voraussetzungen und Regelungen zu beachten. Die Inanspruchnahme ist unter anderem von Rechtsform und Gewinnsituation abhängig. Dies gilt es im Zuge einer individuellen Beratung abzuklären. Stand: 29. Juli 2024 Steuerliche Maßnahmen für Betroffene von Hochwasserkatastrophen
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat die bestehende umfangreiche Information zu steuerlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwasserkatastrophen erneuert und veröffentlicht. Darin finden sich detaillierte Information zu:
Die gesamte Info ist auf findok.bmf.gv.at unter „Information des BMF über steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit den aktuellen Hochwasserkatastrophen“ nachzulesen. Das BMF weist darauf hin, dass die Beurteilung des konkreten Sachverhaltes der zuständigen Abgabenbehörde obliegt. Stand: 01. August 2024 Tipps für das nächste Event Ihres Unternehmens
Veranstaltungen sind eine gute Methode, um das eigene Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken und direkte Kundenkontakte zu fördern. Veranstaltungen wie Workshops, Webinare oder lokale Events können ein entscheidender Schritt zur Kundengewinnung und -bindung sein. Hier einige Tipps dazu:
Stand: 29. Juli 2024 Juli 2024Energiekostenpauschale 2 (für 2023) für Kleinunternehmen bis 8.8.2024 beantragen!
Die Energiekostenpauschale 2 für die Energiekosten des Jahres 2023 von Kleinst- und Kleinunternehmen (Jahresumsatz 2023: € 10.000,00 - € 400.000,00) beträgt als Pauschalförderung zwischen € 167,50 und € 2.685,00 und wird abhängig von der Branche und dem Jahresumsatz berechnet. Ansuchen auf Förderungen für die Energiekostenpauschale 2 sind im Zeitraum 20. Juni 2024 bis 8. August 2024 bis 12:00 Uhr unter Verwendung des „Unternehmensserviceportals“ (USP) einzubringen. Für die Beantragung benötigt man eine ID-Austria, eine Registrierung im Unternehmensserviceportal (USP) und eine korrekte Klassifikation des Unternehmens gemäß seinem wirtschaftlichen Schwerpunkt durch die Statistik Austria (ÖNACE-Code). Für die Beantragung sind alle Voraussetzungen und Regelungen der Richtlinie „Energiekostenpauschale für Unternehmen“ einzuhalten. Die Richtlinie, alle Voraussetzungen sowie detaillierten und aktuellen Infos (FAQ) zur Energiekostenpauschale für Unternehmen finden Sie auf www.energiekostenpauschale.at. Diese Informationen sind auf dem Stand vom 25.6.2024. Stand: 26. Juni 2024 Welche steuerlichen Änderungen sollen mit dem Abgabenänderungsgesetz 2024 geregelt werden?
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2024 (Regierungsvorlage) sollen einige Gesetze punktuell geändert werden. Hier eine Übersicht zu einigen steuerlichen Hauptgesichtspunkten (Auswahl): Übertragungen von Wirtschaftsgütern aus dem Gesellschaftsvermögen einer Personengesellschaft in das Privat- oder Sonderbetriebsvermögen sollen im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt werden. Im Körperschaftsteuergesetz wurden unter anderem Bestimmungen zur Gruppenbesteuerung angepasst. Im Investmentfondsgesetz erfolgten unter anderem Klarstellungen, was unter Einkünfte im Sinne des § 27 EStG (Einkünfte aus Kapitalvermögen) zu verstehen ist. Im Umsatzsteuergesetz soll
Im Gebührengesetz sollen unter anderem für Beilagen und Zeugnisse, die elektronisch übermittelt/ausgestellt wurden, Begünstigungen geschaffen werden. Auch das Mindestbesteuerungsgesetz und die Bundesabgabenordnung wurden geändert. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten. Über einzelne Aspekte informieren wir nach Veröffentlichung des beschlossenen Gesetzes in den kommenden Ausgaben. Stand: 26. Juni 2024 Aufladen des E-Firmenautos: Ist ein Sachbezug zu versteuern?
Stellt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer (E-Auto) für nicht beruflich veranlasste Fahrten, einschließlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, zur Verfügung, gelten folgende steuerliche Regelungen:
Weitere Informationen dazu finden sich in den Lohnsteuerrichtlinien und einer Anfragebeantwortung des Finanzministeriums (www.bmf.gv.at unter Fachinformationen – Lohnsteuer zum Thema „Sachbezugswerteverordnung betreffend E-Ladestationen, Kostenersätze für Ladekosten, Spezialfahrzeuge und Oldtimer“). Stand: 26. Juni 2024 Familienbeihilfe: Wie viel können Studierende dazuverdienen?
Der Anspruch auf Familienbeihilfe für ein Kind ist an unterschiedliche Voraussetzungen gebunden. Unter anderem durften bisher Kinder ab dem Kalenderjahr, in dem sie das 20. Lebensjahr vollenden, pro Jahr nur € 15.000,00 (Rechtsstand Anfang Juni 2024) verdienen, ohne dass der Familienbeihilfeanspruch in voller Höhe verloren geht. Im Nationalrat ist nun in einem selbständigen Antrag vorgesehen, dass dieser Wert rückwirkend per 1.1.2024 auf € 16.455,00 angehoben wird. Ab 2025 soll dieser Wert valorisiert werden. Bei Drucklegung dieses Artikels war die Gesetzwerdung allerdings noch abzuwarten. Für diese Grenze ist das zu versteuernde Einkommen relevant: Bruttogehalt (ohne Sonderzahlungen) minus Sozialversicherungsbeiträge. Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensionen und jenes Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, bleiben unter anderem außer Betracht. Für die Zuverdienstgrenze der Familienbeihilfe ist eine „Jahresdurchrechnung“ relevant, d. h. es gibt keine monatliche Betrachtungsweise. Übersteigt das Einkommen im Kalenderjahr die Zuverdienstgrenze, ist jener Teil der Familienbeihilfe, der den Grenzbetrag (Zuverdienstgrenze) überschritten hat, zurückzuzahlen. Stand: 26. Juni 2024 Neue Dokumentationspflichten bei Entsendungen
Mit 28.3.2024 wurde in Österreich die EU-Transparenzrichtlinie umgesetzt, welche unter anderem im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) erweiterte Pflichten im Zusammenhang mit der Ausstellung von Dienstzetteln oder Mindestangaben bei Dienstverträgen vorsieht. Auch bei Auslandsdienstzetteln (Entsendevereinbarungen) wurden die Mindestangaben erweitert und der Auslandsdienstzettel hat bei Auslandstätigkeiten von mehr als einem Monat nunmehr folgende Inhalte zu umfassen:
Kein gesonderter Auslandsdienstzettel muss hingegen erstellt werden, wenn die angeführten Inhalte bereits im Arbeitsvertrag oder in einem sonstigen Dokument enthalten sind. StrafbestimmungenWird auf die Ausstellung eines Auslandsdienstzettels verzichtet, so drohen Verwaltungsstrafen zwischen € 100,00 und € 436,00. Sind mehr als 5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer betroffen oder liegt bereits ein Verstoß innerhalb der letzten drei Jahre vor, so erhöht sich die Verwaltungsstrafe auf € 500,00 bis € 2.000,00. Auch wenn für mehrere Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer kein Auslandsdienstzettel ausgestellt wurde, liegt nur eine Verwaltungsübertretung vor, weshalb keine Strafkumulation erfolgt. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nach Einleitung eines Strafverfahrens von der Verhängung einer Geldstrafe gänzlich abzusehen, wenn die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber nachweislich in der Zwischenzeit den Auslandsdienstzettel ausgehändigt hat und das Verschulden nur als gering zu bewerten ist. Stand: 26. Juni 2024 Wie hoch ist der Anstieg der Stundungszinsen ab 1.7.2024?
Werden Abgaben nicht fristgerecht entrichtet, so kann das Finanzamt Einbringungsmaßnahmen setzen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Abgabenbehörde auf Ansuchen des Abgabenpflichtigen das Hinausschieben des Zeitpunktes der Entrichtung der Abgaben (Stundung) oder die Entrichtung in Raten bewilligen. Bewilligt die Behörde eine Zahlungserleichterung, so fallen Stundungszinsen an. Stundungszinsen, die den Betrag von € 50,00 nicht erreichen sind nicht festzusetzen. Bis zum 30.6.2024 galt aufgrund der Corona-Gesetzgebung ein ermäßigter Stundungszinssatz von 2 % über dem Basiszinssatz. Ab 1.7.2024 gilt nun wieder der Zinssatz von 4,5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Der Zinssatz beträgt daher ab 1.7.2024 8,38 % (Informationsstand Mitte Juni 2024). Stand: 26. Juni 2024 Wie hoch ist der Klimabonus 2024?
Die Höhe des Klimabonus 2024 setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Alle Anspruchsberechtigten bekommen den Sockelbetrag in Höhe von € 145,00. Zusätzlich kann der Regionalausgleich in Abhängigkeit vom Hauptwohnsitz zustehen. Dieser beträgt 2024 € 145,00, € 100,00, € 50,00 oder € 0,00 für Erwachsene. Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) bekommen die Hälfte. Kann man aufgrund einer Behinderung keine Öffis nutzen, so erhält man den höchsten Klimabonus. Die Auszahlungen beginnen im Herbst 2024. Weitere Informationen finden Sie unter www.klimabonus.gv.at. Stand: 26. Juni 2024 Was ist eine Negativsteuer?
Ist die Einkommensteuer nach Anwendung des Tarifs, nach Abzug des Familienbonus Plus (maximal in Höhe der bestehenden Steuer) und nach Berücksichtigung der weiteren Absetzbeträge negativ, so ist der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag inkl. der Kinderzuschläge gutzuschreiben. Zudem bekommen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, die aufgrund ihres geringen Einkommens keine Einkommensteuer zahlen, bis zu 55 % von bestimmten Werbungskosten zurück. Dazu zählen insbesondere die Beiträge zur Pflichtversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung. Die Gutschrift beträgt für 2024 max. € 463,00 (in 2023 € 421,00) pro Jahr. Pendlerinnen bzw. Pendler erhalten für 2024 max. € 579,00 (in 2023 € 526,00) pro Jahr. Hat man Anspruch auf den Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, ist der maximale Betrag dieser SV-Rückerstattung um € 752,00 (Wert 2024, in 2023 € 684,00) zu erhöhen. Pensionistinnen bzw. Pensionisten, die keine Lohn- bzw. Einkommensteuer bezahlen und Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag haben, erhalten vom Finanzamt eine Gutschrift von 80 % der Sozialversicherungsbeiträge – maximal € 637,00 (Wert 2024, in 2023 € 579,00). Stand: 26. Juni 2024 Krisen: Tipps zur Vorbereitung
Krisen sind unvermeidbar und können in verschiedenen Formen auftreten, sei es durch z. B. wirtschaftliche Abschwünge oder unerwartete betriebliche Herausforderungen. Auch für kleinere Unternehmen ist es essenziell, gut vorbereitet zu sein, um solchen Situationen erfolgreich zu begegnen. Hier einige Tipps zur Vorbereitung:
Stand: 26. Juni 2024 Juni 2024Konjunkturpaket bringt Änderung der Liebhabereiverordnung für Vermietungen
Um infolge der steigenden Zinsen den Konjunktureinbruch in der Baubranche abzufedern, wurde ein Paket geschnürt, welches neben diversen steuerlichen Erleichterungen und Fördermaßnahmen auch eine Änderung der Liebhabereiverordnung vorsieht. Verlängerung der Prognosezeiträume für LiebhabereiDie Liebhabereiverordnung differenziert in Bezug auf Vermietungen zwischen der „kleinen Vermietung“ und der „großen Vermietung“. Unter die „kleine Vermietung“ fällt die Vermietung von Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Mietwohngrundstücken mit qualifizierten Nutzungsrechten, während sich die „große Vermietung“ auf die entgeltliche Überlassung von (nicht parifizierten) Gebäuden bezieht. Im Zuge der Änderung der Liebhabereiverordnung wurde nunmehr der Prognosezeitraum zur Erzielung eines Gesamtüberschusses sowohl für die kleine als auch die große Vermietung um jeweils fünf Jahre verlängert. Der Prognosezeitraum beträgt bei der „kleinen Vermietung“ nunmehr 25 Jahre (bislang: 20 Jahre) ab Beginn der entgeltlichen Überlassung bzw. höchstens 28 Jahre (bislang: 23 Jahre) ab dem erstmaligen Anfallen von Aufwendungen (Ausgaben). Bei der „großen Vermietung“ beträgt der Prognosezeitraum nunmehr 30 Jahre (bislang: 25 Jahre) ab Beginn der entgeltlichen Überlassung, höchstens 33 Jahre (bislang: 28 Jahre) ab dem erstmaligen Anfallen von Aufwendungen (Ausgaben). Die verlängerten Betrachtungszeiträume in Bezug auf die Liebhaberei sind auf Vermietungen anzuwenden, deren Prognosezeitraum nach dem 31.12.2023 beginnt. Stand: 27. Mai 2024 Wie ist der Handwerkerbonus geregelt?
Das bestehende Bundesgesetz über die Förderung von Handwerkerleistungen wurde novelliert. Hier die Eckpunkte der Änderungen:
Der Handwerkerbonus kann ab 15.7.2024 auf handwerkerbonus.gv.at beantragt werden. Dort finden sich weitere aktuelle Informationen und eine umfassende FAQ-Information. Stand: 27. Mai 2024 Wie ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz bei Reparaturdienstleistungen geregelt?
Der Normalsteuersatz für entsprechend dem Umsatzsteuergesetz steuerpflichtige Umsätze beträgt in Österreich 20 % der Bemessungsgrundlage. Allerdings kennt das Umsatzsteuergesetz auch die ermäßigten Steuersätze von 10 %, 13 %, 19 % und 0 %. Die entsprechenden Tatbestände, die zum jeweiligen Steuersatz führen, sind im Gesetz und seinen Anlagen angeführt. Abgrenzungen sind in der Praxis oft nicht einfach vorzunehmen. So unterliegen seit 1.1.2021 auch Reparaturdienstleistungen (einschließlich Ausbesserung und Änderung) betreffend Fahrräder, Schuhe, Lederwaren, Kleidung oder Haushaltswäsche dem ermäßigten Steuersatz in Höhe von 10 %. Die Umsatzsteuerrichtlinien, als Rechtsmeinung des Finanzministeriums, führen dazu unter anderem wie folgt aus: Von der Begünstigung sind auch Elektrofahrräder umfasst, nicht jedoch andere Krafträder. Nicht begünstigt sind Lieferungen inklusive Werklieferungen. Unter Lederwaren sind jedenfalls Waren im Sinne des Kapitels 42 der Kombinierten Nomenklatur zu verstehen. Haushaltswäsche ist ein Sammelbegriff, der z. B. Bettwäsche, Polsterbezüge, Geschirrtücher, Handtücher, Tischdecken, Tischsets, Vorhänge umfasst. Polstermöbel gelten hingegen nach dem allgemeinen Begriffsverständnis nicht als Haushaltswäsche. Der Begriff Kleidung ist unabhängig vom Material, aus dem diese besteht. Die Reinigung von Kleidung fällt nicht unter den ermäßigten Steuersatz von 10 %, da die Reinigung keine Reparaturleistung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes darstellt. Eine begünstigte Reparatur betreffend Fahrräder, Schuhe, Lederwaren, Kleidung oder Haushaltswäsche wird jedenfalls dann angenommen, wenn der Entgeltsanteil, welcher auf das bei der Reparatur verwendete Material entfällt, weniger als 50 % des für die Reparatur geleisteten Gesamtentgelts beträgt. Stand: 27. Mai 2024 Betriebsübergaben: Erleichterungen durch das Grace-Period-Gesetz
Betriebsübergaben (insbesondere bei Familienunternehmen) sollen mit dem Grace-Period-Gesetz (Regierungsvorlage) erleichtert werden. Das Grace-Period-Gesetz soll Änderungen in der Bundesabgabenordnung, der Gewerbeordnung, und dem Arbeitnehmerschutzgesetz bringen. In der Bundesabgabenordnung sollen dabei eigene Bestimmungen zur Begleitung einer Unternehmensübertragung geschaffen werden. Hier einige Eckpunkte daraus: Die Begleitung einer Unternehmensübertragung ist möglich, wenn eine natürliche Person einen (Teil-)Betrieb oder einen Mitunternehmeranteil unter bestimmten Voraussetzungen an einen ihrer Angehörigen übertragen möchte. Während der Begleitung der Unternehmensübertragung besteht eine erhöhte Offenlegungspflicht und ein laufender Kontakt zwischen der bzw. dem voraussichtlichen Erwerberin/Erwerber und den Organen des Finanzamtes (Klärung abgabenrechtlicher Fragen, Auskünfte über bestimmte Sachverhalte). Das Finanzamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen für die Begleitung der Unternehmensübertragung zu prüfen und wird dann eine Außenprüfung des Antragstellenden und gegebenenfalls der Mitunternehmerschaft, deren Anteile er zu übertragen beabsichtigt, durchführen. Nach Beendigung der Begleitung einer Unternehmensübertragung sind die von dieser umfassten (Teil-)Betriebe für die jeweils umfassten Zeiträume von einer Außenprüfung auszunehmen. Bei der Gewerbeanmeldung soll kein Firmenbuchauszug vorzulegen sein – dies wird durch die elektronische Validierung des Firmenbuchstandes ersetzt. Auch die Genehmigungen gewerblicher Betriebsanlagen sollen flexibilisiert werden. Dies betrifft insbesondere die Frage, welchen Konkretisierungsgrad Einreichunterlagen haben müssen. Die Arbeitgeberverpflichtung zur Mitteilung der Sicherheitsvertrauenspersonen an das Arbeitsinspektorat bei Betriebsübernahme soll nicht unmittelbar nach Bestellung der Sicherheitsvertrauensperson bestehen, sondern kann innerhalb des zweijährigen Zeitraums ab der Betriebsübergabe vorgenommen werden. Bei Betriebsübergaben soll eine Einberufung des Arbeitsschutzausschusses nach Erfordernis aber nur mindestens einmal innerhalb des 2-Jahres-Zeitraums erfolgen müssen. Auch die Formerfordernisse, die in Zusammenhang mit dem Vorsitz, der Einladung und dem Protokoll vorgesehen sind, sollen in der zweijährigen Periode nach Betriebsübergabe nicht gelten. Das geplante Gesetz lag bei Drucklegung dieses Artikels als Nationalratsbeschluss vor. Die weitere Gesetzwerdung bleibt abzuwarten. Stand: 27. Mai 2024 Neue Selbständige: Energiekostenzuschuss 2023
Neue Selbständige, die im Zeitraum 1.1.2023 bis 31.12.2023 durchgehend in der Krankenversicherung pflichtversichert waren, haben Anspruch auf einen Energiekostenzuschuss, sofern die endgültige oder vorläufige monatliche Beitragsgrundlage für den Monat Dezember 2023 die Höchstbeitragsgrundlage (€ 6.825,00) nicht erreicht. Die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen erfolgt zum 1.6.2024. Nachträgliche Sachverhaltsänderungen haben keinen Einfluss auf den Anspruch. Der Energiekostenzuschuss wird in Höhe von € 410,00 im Rahmen der Beitragsvorschreibung für das dritte Quartal 2024 auf dem Beitragskonto der versicherten Person gutgeschrieben. Auch für Selbständige, die aufgrund von Übergangsbestimmungen noch immer im ASVG versichert sind, gibt es einen Zuschuss für 2023 und eine Nachzahlung für 2022. Stand: 27. Mai 2024 Muss eine Schenkung gemeldet werden?
Anzeigepflicht besteht für Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden, wenn im Zeitpunkt des Erwerbes mindestens eine Beteiligte bzw. ein Beteiligter einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder die Geschäftsleitung im Inland hatte. Zu melden sind insbesondere Schenkungen von:
Die Anzeige ist entweder von den beteiligten Personen (Schenkende, Beschenkte) oder von am Vertrag mitwirkenden Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten und Notarinnen/Notaren, zur ungeteilten Hand (d. h. wenn eine dieser Person die Anzeige einbringt, sind die anderen nicht mehr dazu verpflichtet) binnen einer Frist von drei Monaten ab Erwerb einzubringen. Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind unter anderem:
Das vorsätzliche Unterlassen der Anzeige ist eine Finanzordnungswidrigkeit (Geldstrafe bis zu 10 % des gemeinen Werts der nicht angezeigten Erwerbe). Alle zur Meldung verpflichteten Personen können gestraft werden. Eine Selbstanzeige ist bis zu einem Jahr möglich, ab dem Ablauf der dreimonatigen Meldepflicht. Stand: 27. Mai 2024 Tipps zum Innovationsmanagement in KMU
Innovationsmanagement kann auch für kleine Unternehmen entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristiges Wachstum zu sichern. Hier sind einige Tipps, die Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer dabei unterstützen können, Innovationsprozesse zu gestalten:
Stand: 27. Mai 2024 Mai 2024Wie wurden die Mindestangaben des Dienstzettels erweitert?
Der österreichische Gesetzgeber hat in Umsetzung der EU-Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union unter anderem das Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (AVRAG) geändert. Dieser Artikel behandelt daraus nur die Erweiterungen der Mindestangaben des sogenannten Dienstzettels und ist nur eine Übersicht zu den Eckpunkten der Neuerungen. Laut AVRAG muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber unverzüglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag (Dienstzettel) aushändigen. Neu ist, dass dies nach Wahl des Arbeitnehmers in elektronischer Form übermittelt werden muss. Ein Dienstzettel muss nicht ausgehändigt werden, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wird, der alle Mindestangaben eines Dienstzettels umfasst. Die bisherige Ausnahme, wenn die Dauer des Dienstverhältnisses höchstens ein Monat beträgt, entfällt nun aber. Folgende Angaben muss ein Dienstzettel mindestens umfassen (Neuerung in Fettdruck):
Zusätzlich können weitere Angaben erforderlich sein, wenn der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlassen oder im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses länger als einen Monat im Ausland tätig wird. Auch diese Angaben wurden erweitert. Jede Änderung der Angaben ist dem Arbeitnehmer unverzüglich, spätestens jedoch am Tag ihres Wirksamwerdens (bisher spätestens jedoch einen Monat nach ihrer Wirksamkeit), schriftlich mitzuteilen, es sei denn, die Änderung erfolgte durch Änderung von Gesetzen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (z. B. Kollektivvertrag), auf die verwiesen wurde, oder die den Grundgehalt oder -lohn betreffen, oder die Änderung ergibt sich unmittelbar aus der dienstzeitabhängigen Vorrückung in derselben Verwendungs- oder Berufsgruppe des Kollektivvertrages. Zudem wird das Nichtaushändigen des Dienstzettels unter Strafe gestellt. Die gesetzlichen Änderungen bezüglich der Angaben am Dienstzettel gelten für Eintritte seit dem 28.03.2024. Stand: 28. April 2024 Was ändert sich steuerlich bei Gebäudeabschreibung und -sanierung?
Eine kürzlich erfolgte Änderung des Einkommensteuergesetzes sieht erweiterte Möglichkeiten der beschleunigten Abschreibung bei Herstellungsaufwand im Zuge von Sanierungsmaßnahmen bei Gebäuden vor. Weiters ist für Neubauten, die in einem bestimmten Zeitraum fertiggestellt werden und definierten ökologischen Standards entsprechen, eine verbesserte vorzeitige Abschreibungsmöglichkeit durchführbar. Schließlich soll zeitlich befristet ein „Öko-Zuschlag“ für klimafreundliche Sanierungsmaßnahmen von vermieteten Wohngebäuden gewährt werden. Beschleunigte Abschreibung von SanierungsmaßnahmenUnter bestimmten Voraussetzungen konnten bisher bereits Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen, die Herstellungsaufwand darstellen, über Antrag beschleunigt auf 15 Jahre verteilt abgesetzt werden. Zusätzlich zu den schon bisher erfassten Fällen können ab 2024 auch Sanierungsmaßnahmen beschleunigt auf 15 Jahre verteilt abgesetzt werden, für die von der zuständigen Förderstelle eine Bundesförderung nach dem 3. Abschnitt des Umweltförderungsgesetzes (UFG) ausbezahlt wird. Sollte eine Förderung tatsächlich nicht zur Auszahlung kommen, obwohl die inhaltlichen Voraussetzungen für die Förderung dem Grunde nach vorliegen, steht die Begünstigung auch dann zu, wenn das Vorliegen der Fördervoraussetzungen plausibilisiert ist. Die Kriterien dafür und die näheren Rahmenbedingungen sollen im Verordnungsweg festgelegt werden (in Anlehnung an die Öko- IFB-Verordnung). Vorzeitige AbschreibungDie Absetzung für Abnutzung (AfA) beträgt für 2024-2026 fertiggestellte Wohngebäude auch in den beiden der erstmaligen Berücksichtigung nachfolgenden Jahren höchstens das Dreifache des gesetzlichen Prozentsatzes. In Kombination mit den bestehenden Regelungen für vorzeitige Abschreibung bedeutet dies, dass für bestimmte Wohngebäude in den ersten drei Jahren der dreifache AfA-Satz angewendet werden kann. Da für Wohngebäude ein AfA-Satz von 1,5 % vorgesehen ist, beträgt das Höchstausmaß der erhöhten Jahres-AfA 4,5 %. Sofern für das erste Jahr höchstens dieser AfA-Satz angewendet wird, kann er auch in den beiden Folgejahren angewendet werden. Die Halbjahresabschreibungsregelung ist nicht anzuwenden. Dies gilt nur für Wohngebäude, die zumindest dem „Gebäudestandard Bronze“ nach dem auf der entsprechenden OIB-Richtlinie basierenden „klima-aktiv Kriterienkatalog in der aktuellen Version 2020“ des Umweltministeriums entsprechen. Öko-ZuschlagBei Gebäuden, soweit diese zu Wohnzwecken überlassen werden, kann ein Öko-Zuschlag in Höhe von 15 % für Aufwendungen für bestimmte thermisch-energetische Sanierungen oder für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungssystem als Betriebsausgabe bzw. als Werbungskosten berücksichtigt werden. Bei betrieblichen Einkünften steht der Öko-Zuschlag erstmalig in jenem Wirtschaftsjahr, das nach dem 31.12.2023 beginnt und letztmalig im darauffolgenden Wirtschaftsjahr zu. Er steht nicht für Wirtschaftsgüter zu, für die ein Investitionsfreibetrag in Anspruch genommen wird. Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung steht der Öko-Zuschlag für Aufwendungen zu, die in den Kalenderjahren 2024 und 2025 anfallen. Werden die dem Öko-Zuschlag zugrundeliegenden Aufwendungen verteilt berücksichtigt, kann der Öko-Zuschlag entweder zur Gänze sofort oder entsprechend der Verteilung berücksichtigt werden. Stand: 28. April 2024 Erhöhung der Freigrenze für Arbeitgeberzuschüsse zur Kinderbetreuung
Um Eltern im Rahmen der Kinderbetreuung zu entlasten, wurden im Zuge des Progressionsabgeltungsgesetzes 2024 (PrAG 2024) die Steuer- und Sozialversicherungsfreigrenze für Arbeitgeberzuschüsse zur Kinderbetreuung auf € 2.000,00 pro Jahr und Kind (bis 2023: € 1.000,00) angehoben sowie die Anspruchsvoraussetzungen ausgeweitet. Steuerfreiheit für ArbeitgeberzuschüsseArbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber können Arbeitnehmenden einen Zuschuss zur Kinderbetreuung steuer- und beitragsfrei im Ausmaß von bis zu € 2.000,00 (bis 2023: € 1.000,00) pro Kind und Jahr gewähren. Begünstigt sind Arbeitnehmende, denen für das Kind mehr als sechs Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag zusteht und deren Kind zu Beginn des Kalenderjahres das 14. Lebensjahr (bis 2023: 10. Lebensjahr) noch nicht vollendet hat. Die Abgabenfreiheit liegt nur dann vor, wenn der Arbeitgeber allen Arbeitnehmenden oder Gruppen von Arbeitnehmenden, für die ein Zuschuss gewährt werden kann, diesen einräumt. Ansuchen und DokumentationVor einer Auszahlung haben Arbeitnehmende dem Arbeitgeber schriftlich Folgendes zu erklären (Formular L 35):
Die Erklärung ist zum Lohnkonto zu nehmen. AuszahlungDer Zuschuss ist vom Arbeitgeber entweder direkt an eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung oder an eine pädagogisch qualifizierte Person zu leisten. Er kann auch in Form von Gutscheinen geleistet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Gutscheine ausschließlich bei institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden können. Neu ist, dass ab dem Kalenderjahr 2024 zudem auch die Kosten einer zuvor durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer selbst verausgabten Kinderbetreuung durch den Arbeitgeber gegen Vorlage der Rechnung ganz oder teilweise ersetzt werden können. Stand: 28. April 2024 Grundbuchseintragungsgebühr: Befreiung bei dringendem Wohnbedürfnis möglich
Der Nationalrat hat eine temporäre Befreiung von Gebühren für Eintragungen in das Grundbuch unter bestimmten Voraussetzungen beschlossen. Voraussetzung für die Gebührenbefreiung der Eintragung von Eigentumsrechten im Grundbuch ist unter anderem, dass der Eintragung ein entgeltliches Rechtsgeschäft zugrunde liegt, das nach dem 31.3.2024 geschlossen wurde und der Antrag auf Eintragung des jeweiligen Rechts nach dem 30.6.2024, aber vor dem 1.7.2026, beim Grundbuchsgericht einlangt. Für Eintragungen zum Erwerb des Eigentums zum Beispiel muss das auf der Liegenschaft errichtete oder zu errichtende Gebäude oder das Bauwerk der Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses der/des einzutragenden Eigentümerin/Eigentümers dienen (Wohnstätte). Als Nachweis dafür ist die Meldung des Hauptwohnsitzes und die Aufgabe des bisherigen Hauptwohnsitzes erforderlich (Fristen zur Einreichung sind zu beachten). Vererbte oder geschenkte Immobilien sind nicht von der Gebühr befreit. Für die Befreiung der Eintragung von Pfandrechten (zum Erwerb dieser Liegenschaft oder zur Errichtung oder Sanierung der Wohnstätte) gelten unter anderem weitere Regelungen. Die Gebührenbefreiung besteht bis zu einer Bemessungsgrundlage von € 500.000,00. In dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage über € 500.000,00 liegt, sind Eintragungsgebühren zu entrichten. Ab einer Bemessungsgrundlage von € 2 Millionen besteht keine Gebührenbefreiung. Die Gebührenbefreiung fällt nachträglich weg, wenn innerhalb von fünf Jahren entweder das Eigentumsrecht an der Liegenschaft oder dem Bauwerk aufgegeben wurde oder das dringende Wohnbedürfnis an der Wohnstätte wegfällt. Dieser Artikel behandelt nur einige Eckpunkte der neuen Gebührenbefreiung. Weitere Regelungen sind zu beachten. Bei Drucklegung dieses Artikels war die Gesetzwerdung noch abzuwarten. Stand: 28. April 2024 Wallbox beim Dienstnehmer für das E-Firmenauto: Ist ein Sachbezug zu versteuern?
Stellt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer ein Elektroauto (CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer) für nicht beruflich veranlasste Fahrten, einschließlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, zur Verfügung, so ist ein Sachbezugswert von Null anzusetzen. Ersetzt nun der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ganz oder teilweise auch die Kosten für die Anschaffung einer Ladeeinrichtung für dieses Kraftfahrzeug oder schafft er für den Arbeitnehmer eine Ladeeinrichtung für dieses Kraftfahrzeug an, ist nur der € 2.000,00 übersteigende Wert als Einnahme bzw. geldwerter Vorteil anzusetzen. Wenn der Arbeitgeber die Ladeeinrichtung für dieses Kraftfahrzeug least und dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, ist auf die im Leasingvertrag der Berechnung der Leasingrate zugrundeliegenden Anschaffungskosten der Ladeeinrichtung abzustellen und als Sachbezug jener Teil der Leasingrate anzusetzen, der sich aus dem Verhältnis des € 2.000,00 übersteigenden Wertes zu den Anschaffungskosten ergibt. Das Finanzministerium hat zudem auf seiner Homepage www.bmf.gv.at unter Fachinformationen – Lohnsteuer zum Thema „Sachbezugswerteverordnung betreffend E-Ladestationen, Kostenersätze für Ladekosten, Spezialfahrzeuge und Oldtimer“ zum Thema E-Ladestationen folgende Themen behandelt:
Stand: 28. April 2024 Warum benötigt Ihr Unternehmen eine Kostenrechnung?
Eine fundierte Kostenrechnung bietet nicht nur Einblicke in die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens, sondern kann auch entscheidend dazu beitragen, gute Geschäftsentscheidungen zu treffen und die Rentabilität zu steigern. Die Kostenrechnung ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Kostenarten Ihres Unternehmens zu identifizieren und zu quantifizieren; seien es direkte Material- und Arbeitskosten oder indirekte Betriebsausgaben. Indem Sie Ihre Kosten genau verfolgen, können Sie ein klares Bild davon erhalten, welche Produkte oder Dienstleistungen am rentabelsten sind und welche möglicherweise einer Überprüfung bedürfen. Dieses Verständnis ermöglicht es Ihnen, Ressourcen dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen bringen. Eine solide Kostenrechnung kann Ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen über Ihre Preisgestaltung zu treffen. Durch das Verständnis Ihrer Kostenstruktur können Sie sicherstellen, dass Ihre Preise ausreichend sind, um alle Kosten zu decken und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine gut durchdachte Kostenrechnung ist wesentlich für die langfristige Planung und Budgetierung Ihres Unternehmens. Indem Sie Ihre erwarteten Kosten genau prognostizieren, können Sie realistische Ziele setzen und Strategien entwickeln, um diese zu erreichen. Stand: 28. April 2024 April 2024Umsatzsteuer: Kann ein Vertrag eine Rechnung sein?
Das Umsatzsteuergesetz regelt detailliert, wann eine Unternehmerin bzw. ein Unternehmer berechtigt, oder auch verpflichtet ist, Rechnungen auszustellen. Auch sind unter anderem sehr genau die erforderlichen Rechnungsbestandteile geregelt. Dies ist insbesondere wichtig, da ein allfällig möglicher Vorsteuerabzug von der Einhaltung dieser Vorschriften abhängt. Als Rechnung gilt jede Urkunde, mit der ein Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet. Es ist nicht erforderlich, dass diese Urkunde die Bezeichnung „Rechnung" trägt. Als Rechnungen können auch elektronische Rechnungen gelten (hier sind gesonderte Bestimmungen zu beachten). Bei der letzten Wartung der Umsatzsteuerrichtlinien (Rechtsmeinung des Finanzministeriums) wurde nun unter anderem folgendes zu diesem Thema ergänzt: Um als Rechnung anerkannt werden zu können, muss ein Dokument die Mehrwertsteuer ausweisen und jene Angaben enthalten („Rechnungsangaben"), die erforderlich sind, um feststellen zu können, ob die materiellen Voraussetzungen für das Recht auf Vorsteuerabzug erfüllt sind. Hingegen gilt ein Vertrag nicht als Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, wenn dies in diesem Vertrag ausdrücklich festgehalten wird. Zu beachten ist jedenfalls, dass der leistende Unternehmer in Bezug auf einen Umsatz nur eine Rechnung (mit gesondertem Steuerausweis) ausstellen darf. Stellt er eine zweite Rechnung für denselben Umsatz aus, so kann sich daraus eine Steuerschuld aufgrund des unberechtigten Steuerausweises ergeben. Davon zu unterscheiden ist die Anfertigung von Duplikaten oder Abschriften von Rechnungen. Soll es zu keiner Steuerschuld aufgrund des unberechtigten (nochmaligen) Steuerausweises kommen, muss die Rechnung eindeutig als „Duplikat", „Zweitschrift" und dgl. gekennzeichnet sein. Stand: 27. März 2024 Sachbezug aufgrund von Zinsersparnissen ab 2024
Aufgrund einer Änderung der Sachbezugswerteverordnung gelten folgende Regelungen für Zinsenersparnisse bei unverzinslichen oder zinsverbilligten Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen: Die jährliche Zinsenersparnis bei zinsverbilligten Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Zinssatz (Sollzinssatz) und dem entsprechend der unten angeführten Bestimmungen berechneten Prozentsatz. Bei unverzinslichen Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen ist der Prozentsatz entsprechend den Bestimmungen zum unveränderlichen Sollzinssatz anzusetzen. Bei Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen mit einem variablen Sollzinssatz wird der Prozentsatz für jedes Kalenderjahr im jeweiligen Vorjahr ermittelt und vom Finanzminister bis zum 30. November jeden Jahres für das Folgejahr in der Findok (http://findok.bmf.gv.at/findok) veröffentlicht. Der jeweilige Prozentsatz ist für Zeiträume, für die Zinsen variabel festgelegt wurden, maßgeblich. Bei Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen gilt für Zeiträume mit einem unveränderlichen Sollzinssatz Folgendes: Als Prozentsatz ist der von der Österreichischen Nationalbank für den Monat des Abschlusses des Darlehensvertrages veröffentlichte „Kreditzinssatz im Neugeschäft an private Haushalte für Wohnbau mit anfänglicher Zinsbindung über zehn Jahre“, der um 10 Prozent vermindert wird (Referenzzinssatz), anzusetzen. Der Prozentsatz ist für den gesamten Zeitraum, für den Zinsen unveränderlich festgelegt wurden, maßgeblich. Die Höhe der Raten und die Rückzahlungsdauer haben keinen Einfluss auf das Ausmaß des Sachbezuges. Die Zinsenersparnis ist vom aushaftenden Kapital zu berechnen. Die Zinsenersparnis ist ein sonstiger Bezug gemäß Einkommensteuergesetz. Übersteigen Gehaltsvorschüsse und Arbeitgeberdarlehen insgesamt € 7.300,00, ist ein Sachbezug nur vom übersteigenden Betrag zu ermitteln. Obige Bestimmungen auf Gehaltsvorschüsse und Arbeitgeberdarlehen sind ab 2024 anzuwenden, wenn deren Gewährung:
Zu Darlehen, die mit unveränderlichem Sollzinssatz vereinbart wurden, hat das Finanzministerium auf www.bmf.gv.at eine Anfragebeantwortung veröffentlicht. Stand: 27. März 2024 Einkommensteuer: Änderungen bei Kirchenbeitrag und sonstigen Bezügen
Ende Februar hat der Nationalrat zwei Änderungen des Einkommensteuergesetzes beschlossen (Gesetzwerdung war bei Drucklegung dieses Artikels noch abzuwarten). Sonderausgabe KirchenbeitragDie Beiträge anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften können als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Die Obergrenze der Absetzbarkeit des Kirchenbeitrags wurde von bisher € 400,00 auf € 600,00 ab 2024 erhöht. Freigrenzen für sonstige BezügeErhält die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer neben dem laufenden Arbeitslohn von demselben Arbeitgebenden bestimmte sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (wie zum Beispiel 13. und 14. Monatsbezug, Belohnungen), wird die Lohnsteuer für diese sonstigen Bezüge innerhalb des Jahressechstels mit festen Steuersätzen gesondert berechnet. Geregelt ist unter anderem auch, dass die Besteuerung der sonstigen Bezüge mit diesen festen Steuersätzen unterbleibt, wenn das Jahressechstel höchstens € 2.100,00 (Freigrenze) beträgt. In 2024 ist für diese Freigrenze (gemäß § 67 Abs. 1, aber auch § 41 Abs. 4, und § 77 Abs. 4) statt dem Betrag € 2.100,00 der Betrag € 2.447,00 anzuwenden. Auch die Grenze von derzeit € 2.000,00 für 2024 wird angepasst, welche bei einem Jahressechstel bis € 25.000,00 bei Anwendung der 30 % Steuersatz heranzuziehen ist. Wurden die höheren Beträge für diese Lohnzahlungszeiträume noch nicht berücksichtigt, hat der Arbeitgebende für seine Arbeitnehmer eine Aufrollung so bald wie möglich, jedoch spätestens bis 30.6.2024 durchzuführen, sofern die technischen und organisatorischen Möglichkeiten dazu vorliegen. Stand: 27. März 2024 Betriebskindergärten: Was hat sich bezüglich der Lohnsteuerbefreiung ab 2024 geändert?
Von der Einkommensteuer befreit ist der geldwerte Vorteil aus der Benützung einer arbeitgebereigenen elementaren Bildungseinrichtung, die durch alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern sowie durch betriebsfremde Personen genutzt werden kann. Die gewarteten Lohnsteuerrichtlinien erläutern dies nun wie folgt: Der kostenlose oder vergünstigte Besuch elementarer Bildungseinrichtungen (insbesondere Betriebskindergärten) ist ab dem Kalenderjahr 2024 auch dann steuerfrei (kein Sachbezug), wenn diese Einrichtungen ebenfalls durch betriebsfremde Kinder besucht werden können. Dabei spielt es weder eine Rolle, wie hoch der Anteil der Kinder von Arbeitnehmern unter den Kindern insgesamt ist, noch, wie hoch die Gebühr für die Nutzung der Einrichtung (sowohl für Arbeitnehmer als auch betriebsfremde Personen) ist, oder ob diese einen Gewinn erwirtschaftet. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber muss aber die Verfügungsmacht über die elementare Bildungseinrichtung haben. Das bedeutet, dass dem Arbeitgeber das Recht eingeräumt sein muss, selbständig und nach eigenem Belieben über die elementare Bildungseinrichtung zu verfügen. Der Arbeitgeber kann sich auch eines ihm nicht wirtschaftlich zugehörigen Betreibers bedienen (beispielsweise eines Vereins, der auch andere Kinderbetreuungseinrichtungen betreibt), solange die Verfügungsmacht über die elementare Bildungseinrichtung bei ihm verbleibt. Kommt es zur bloßen Anmietung einzelner Plätze bei einer bestehenden elementaren Bildungseinrichtung (z. B. Kindergartenplatz) durch den Arbeitgeber, ist die Voraussetzung der Verfügungsmacht nicht erfüllt; in diesem Fall kann jedoch bei Vorliegen der Voraussetzungen eine andere Steuerbefreiung zur Anwendung kommen. Wird die elementare Bildungseinrichtung von mehreren Arbeitgebern gemeinsam betrieben, ist es ausreichend, wenn jedem Arbeitgeber (anteilig) Verfügungsmacht zukommt. Der Begriff elementare Bildungseinrichtung umfasst alle institutionellen Formen der Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt. Als elementare Bildungseinrichtungen gelten Kindergärten, Kinderkrippen und vergleichbare Einrichtungen entsprechend landesgesetzlicher Regelungen, nicht jedoch öffentliche Pflichtschulen. Stand: 27. März 2024 Ist der Vorsteuerbetrag aus Anzahlungen zu berichtigen, wenn eine Leistung nicht ausgeführt wurde?
Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des Umsatzsteuergesetzes geändert, so haben in der Regel:
Dies gilt unter anderem sinngemäß, wenn für eine vereinbarte Lieferung oder sonstige Leistung ein Entgelt entrichtet, die Lieferung oder sonstige Leistung jedoch nicht ausgeführt worden ist. Insbesondere zu diesem Punkt gab es nun folgende Klarstellung in der letzten Wartung der Umsatzsteuerrichtlinien, die auf einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes beruht: Oben genannte Bestimmung stelle – neben der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten – auf die Anzahlungsbesteuerung ab, bei welcher die Umsatzsteuerschuld bereits dann entsteht, wenn die Anzahlung vereinnahmt, die Lieferung oder sonstige Leistung aber noch nicht ausgeführt wurde. Die bzw. der die Anzahlung Leistende hat das Recht auf Vorsteuerabzug, wenn eine Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet wurde. Unterbleibt in weiterer Folge die Leistung, so sind der vom Anzahlungsempfänger aufgrund der Anzahlung geschuldete Umsatzsteuerbetrag und der vom Anzahlenden in Anspruch genommene Vorsteuerbetrag zu berichtigen. Stand: 27. März 2024 Wie hoch sind die Zuverdienstgrenzen beim Kinderbetreuungsgeld in 2024?
Je nach gewählter Kinderbetreuungsgeldvariante gibt es unterschiedliche Zuverdienstgrenzen, wobei die Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld in 2024 nochmals angehoben wurde. Da das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld einen (teilweisen) Ersatz für die entfallenden früheren Einkünfte darstellt, ist ein Zuverdienst nur im Ausmaß von € 8.100,00 (€ 7.800,00 in 2023) pro Kalenderjahr möglich. Die Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung etwa wäre daher zulässig. Im Rahmen der Zuverdienstgrenze werden nur die Einkünfte desjenigen Elternteils berücksichtigt, der das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld bezieht. Die Einkünfte des anderen Elternteils sind nicht ausschlaggebend. Wird die jährliche Zuverdienstgrenze von € 8.100,00 überschritten, ist nur jener Betrag zurückzuzahlen, um den die Zuverdienstgrenze überschritten wurde (sogenannte Einschleifregelung). Das restliche Kinderbetreuungsgeld muss hingegen nicht zurückgezahlt werden. Beim Bezug des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes (KBG) gilt hingegen eine individuelle Zuverdienstgrenze von 60 % der Letzteinkünfte aus dem relevanten Kalenderjahr vor der Geburt, in dem kein Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde (= individuelle Zuverdienstgrenze), beschränkt auf das drittvorangegangene Jahr. Liegt die ermittelte individuelle Zuverdienstgrenze unter € 18.000,00, so darf der Zuverdienst dennoch € 18.000,00 pro Kalenderjahr betragen. Dies gilt auch in jenen Fällen, in denen keine individuelle Zuverdienstgrenze ermittelt werden kann, weil beispielsweise noch kein Steuerbescheid vorliegt. Analog zum einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld gilt auch hier die Zuverdienstgrenze nur für jenen Elternteil, der das Kinderbetreuungsgeld bezieht. Eine Ausnahme besteht nur bei der Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld. Stand: 27. März 2024 Wie kann Mitarbeiterloyalität auch in Kleinunternehmen gefördert werden?
Die Bindung talentierter und gutausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für kleine Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, um Mitarbeiter zu halten und ihre Loyalität zu stärken:
Stand: 27. März 2024 März 2024Rechtsformwahl: Was ändert sich 2024 aus steuerlicher Sicht?
Für die Auswahl der optimalen Rechtsform sind jedenfalls Haftungsfragen sowie organisatorische, betriebswirtschaftliche und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen zu bedenken. Zentrales Entscheidungskriterium ist aber auch immer wieder die steuerliche Optimierung. Hier haben sich einige Einflussfaktoren im Jahr 2024 geändert:
Auch wenn die genannten Änderungen einen steuerlichen Vorteilhaftigkeitsvergleich in den meisten Fällen wohl nicht signifikant verändern werden, sind sie bei Überlegungen zu einer anstehenden Rechtsformwahl zu berücksichtigen. Eine pauschale Aussage, bei welcher Rechtsform weniger an Steuern und Abgaben in den kommenden Jahren zu entrichten sein wird, ist nicht machbar. Die individuelle Situation muss genau beleuchtet werden. Stand: 26. Februar 2024 Wann haben Arbeitnehmer eine Arbeitnehmerveranlagung abzugeben?
Die Steuer von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in der Regel bereits mit dem Lohnsteuerabzug abgegolten. Die nachfolgende Veranlagung erfolgt dabei entweder freiwillig (Antragsveranlagung), automatisch oder zwingend (Pflichtveranlagung). Verpflichtend muss ein Arbeitnehmer eine Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2023 unter anderem einreichen, wenn das zu veranlagende Einkommen mehr als € 12.756,00 beträgt und
Ab der Veranlagung 2024 gilt obiges auch, wenn die Voraussetzungen des steuerfreien Freiwilligenpauschale nicht vorlagen oder ein geldwerter Vorteil aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung zugeflossen ist und kein oder ein zu geringer Steuerabzug vom Arbeitslohn erfolgt ist. Weiters bestehen einige Sachverhalte, wo Sie das Finanzamt auffordert, eine Arbeitnehmerveranlagung einzureichen. Darüber hinaus ist für Arbeitnehmer unter anderem eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn Kapitaleinkünfte oder Einkünfte aus privaten Grundstücksverkäufen ohne Abfuhr der entsprechenden Sondersteuern (KESt bzw. ImmoESt) erzielt wurden. Sollte keine steuerliche Vertretung vorliegen, so gilt als generelle Frist für die Einreichung der Erklärung in Papierform der 30.4. des Folgejahres oder der 30.6. des Folgejahres für Einreichungen über FinanzOnline. Bei einzelnen Fällen der Veranlagung (gleichzeitig mehrere nichtselbständige Einkünfte, Wegfall des berücksichtigten Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrages) gilt zudem die allgemeine Frist des 30.9. des Folgejahres, unabhängig davon, ob die Erklärung mit dem amtlichen Formular oder elektronisch eingereicht wird. Stand: 26. Februar 2024 Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für 2024
Ein Unterhaltsabsetzbetrag kann unter bestimmten Voraussetzungen zur steuerlichen Entlastung geltend gemacht werden, wenn der gesetzliche Unterhalt geleistet wird, und
Wenn keine vertragliche, gerichtliche oder behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistung erfolgt ist, wird der Unterhaltsabsetzbetrag nur dann zuerkannt, wenn der vereinbarten Unterhaltsverpflichtung in vollem Ausmaß nachgekommen wurde und die Regelbedarfssätze nicht unterschritten wurden. Die Regelbedarfssätze werden jedes Jahr neu festgelegt. Für steuerliche Belange gelten für das Kalenderjahr 2024 folgende Sätze:
Stand: 26. Februar 2024 Wo sind Informationen zum Nullsteuersatz in der Umsatzsteuer für Photovoltaikanlagen zu finden?
Die Umsatzsteuer für die Lieferungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe, Einfuhren sowie Installationen von Photovoltaikmodulen, die nach dem 31.12.2023 und vor dem 1.1.2026 ausgeführt werden bzw. sich ereignen, beträgt aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes 0 %. Dies gilt nur, wenn die Lieferungen oder Installationen an oder die innergemeinschaftlichen Erwerbe bzw. Einfuhren durch den Betreiber erfolgen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Engpassleistung der Photovoltaikanlage nicht mehr als 35 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird und dass die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von bestimmten Gebäuden betrieben wird oder betrieben werden soll. Weiters ist normiert, dass für die entsprechende Photovoltaikanlage bis zum 31.12.2023 kein Antrag auf Investitionszuschuss nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) eingebracht worden ist (zu beachten ist eine Übergangsregelung für Anlagen, die vor dem 1.1.2024 in Betrieb genommen wurden). Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat nun in FAQs Antworten zu einigen Zweifelsfragen in folgenden Bereichen gegeben:
Diese Informationen sind auf der Website des BMF (www.bmf.gv.at) unter Themen / Steuern / Für Unternehmer / Umsatzsteuer / Informationen zu finden (Stand Anfang Februar 2024). Weiters wurden vom BMF Antworten zu Anfragen des Bundesverbandes Photovoltaic Austria und der Landwirtschaftskammer publiziert. Auch wurden Informationen zu Fragen der Wirtschaftskammer in folgenden Bereichen veröffentlicht:
Diese Informationen sind auf der Website des BMF (www.bmf.gv.at) unter Rechtsnews / Steuern-Rechtsnews /Aktuelle Informationen und Erlässe /Fachinformationen-Umsatzsteuer zu finden (Stand Anfang Februar 2024). Stand: 26. Februar 2024 Übernahme der Homeoffice-Regelungen ins Dauerrecht
Da das Homeoffice mittlerweile fixer Bestandteil der Arbeitswelt ist, hat der Gesetzgeber die bis 31.12.2023 befristete Regelung im Rahmen des Progressionsabgeltungsgesetzes 2024 ins Dauerrecht übernommen. Somit können auch im Jahr 2024 nachfolgende Positionen steuerlich geltend gemacht werden: Homeoffice-PauschaleArbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche eine Homeoffice-Tätigkeit gewähren, können den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für die Nutzung dieser eine Homeoffice-Pauschale von max. € 3,00 pro Tag bzw. max. € 300,00 pro Jahr leisten (max. 100 Homeoffice-Tage). Leistet der Arbeitgeber keine oder eine niedrigere Pauschale, besteht auf Ebene des Arbeitnehmers die Möglichkeit zur Geltendmachung von Differenzwerbungskosten. Digitale ArbeitsmittelDie unentgeltliche Überlassung digitaler Arbeitsmittel durch den Arbeitgeber stellt keinen steuerpflichtigen Sachbezug bei Arbeitnehmern dar. Deren Bereitstellung ist durch das Homeoffice-Pauschale abgegolten. Erfolgt eine Anschaffung durch den Arbeitnehmer selbst, stellen die Anschaffungskosten Werbungskosten dar, welche allerdings um das Homeoffice-Pauschale zu kürzen sind, sofern dieses durch den Arbeitgeber oder als Differenzwerbungskosten berücksichtigt wurde. Ergonomisches MobiliarArbeitnehmer können Ausgaben für die Anschaffung von ergonomischem Mobiliar als Werbungskosten geltend machen. Die Höhe der jährlich absetzbaren Kosten ist mit € 300,00 beschränkt, wobei ein Überhang ins Folgejahr vorgetragen werden kann. LohnzettelWeiterhin ist zu beachten, dass Arbeitgeber die Anzahl der Homeoffice-Tage am Lohnkonto sowie auf dem Jahreslohnzettel (L16) zu erfassen haben. Ebenfalls ist auch die Summe des vom Arbeitgeber nicht steuerbar ausgezahlten Homeoffice-Pauschales am Lohnkonto zu erfassen. Stand: 26. Februar 2024 Was ist ein Auskunftsbescheid?
Besteht eine konkrete Rechtsfrage im Hinblick auf eine geplante Umgründung, Verrechnungspreiskonstellation oder im Bereich der Gruppenbesteuerung, so besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Auskunftsbescheids nach § 118 Bundesabgabenordnung eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes dazu einzuholen. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass die verbindliche Anfrage an das Finanzamt neben der Erfüllung notwendiger inhaltlicher Voraussetzungen auch mitunter hohe Kosten verursacht. Der Antrag hat folgende Punkte zu enthalten:
Die Beantwortung im Rahmen des Auskunftsbescheids obliegt dem Finanzamt, das für die Erhebung der betreffenden Abgabe oder für die Erlassung des betreffenden Feststellungsbescheides zuständig ist.
Für den im Rahmen der Beantwortung entstehenden Mehraufwand wird seitens des Finanzamts ein Verwaltungskostenbeitrag eingehoben. Dieser beträgt (im Falle der Bearbeitung) zwischen € 1.500,00 und € 20.000,00 und ist in Abhängigkeit der Umsatzerlöse der Antragsstellerin bzw. des Antragsstellers gestaffelt. Im Falle einer Zurückweisung oder Zurücknahme des Antrags beträgt der Verwaltungskostenbeitrag € 500,00. Stand: 26. Februar 2024 Tipps, wie Mitarbeiter zu einem Spitzenteam werden
Die Unterstützung und Gestaltung von Spitzenteams, die energievoll den Erfolg eines Unternehmens vorantreiben, sind wichtige Aufgaben jeder Führungskraft eines Unternehmens. Hier einige Tipps, wie Sie aus einer Gruppe von Mitarbeitenden ein Spitzenteam gestalten können: Wesentlich ist es, eine tragfähige Vertrauensbasis zwischen Mitarbeitenden, Teamführung und Unternehmensführung aufzubauen. Der Weg zum Vertrauen zu einer Führungsperson führt über Authentizität, faktenbasierte und nachvollziehbare Entscheidungen und Einfühlungsvermögen. Für eine optimale Teamleitung ist insbesondere die Führungsspanne (Anzahl der Teammitglieder) zu beachten. Ist die Führungsspanne zu groß, so leidet die notwendige Aufmerksamkeit für das einzelne Teammitglied. Es ist Klarheit zu schaffen, was in der aktuellen Woche zu tun ist und darauf zu achten, wo das einzelne Teammitglied Unterstützung braucht. Stärken Sie laufend die Zusammenarbeit und die Kommunikation im Team. Erst mit einem Wir-Gefühl können gemeinsame Ziele erreicht werden, die auch seitens der Unternehmensführung klar kommuniziert werden müssen. Ermöglichen Sie Reflexionen im Team: Was können wir gut? Was können wir nicht? Was brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen? An welche Regeln sollen sich alle halten? Stand: 26. Februar 2024 Februar 2024Wie ist der Energiekostenzuschuss für Non-Profit-Organisationen geregelt?
Die Richtlinie zum Energiekostenzuschuss für Non-Profit-Organisationen wurde veröffentlicht. Im Folgenden finden Sie dazu einige Eckpunkte: Förderbare Organisationen sind grundsätzlich
wenn diese nicht oder teilweise nicht unternehmerisch tätig gemäß § 2 UStG sind. Die Verordnung definiert den Begriff NPO und listet eine Reihe von Organisationen auf, die nicht förderfähig sind. Förderbar sind unter bestimmten Voraussetzungen Mehrkosten für die Energiearten Strom, Erdgas, Fernwärme, Fernkälte, Benzin, Diesel, Holzpellets, Hackschnitzel und Heizöl. Für die Bemessung der Förderung sind die förderbaren Kosten, die in der jeweiligen Förderphase sowie im Vergleichszeitraum 2021 angefallen sind, zu ermitteln:
Energiemehrkosten sind grundsätzlich die Differenz zwischen den förderbaren Kosten des Jahres 2021 und den förderbaren Kosten des Jahres 2022 (für Phase 1) sowie des Jahres 2023 (für Phase 2). Von den förderbaren Kosten sind zuvor für dieselben Kosten gewährte Förderungen in Abzug zu bringen. Für die einzelnen Energiearten bestehen gesonderte Bestimmungen. Die Förderung für die Phase 1 (Kalenderjahr 2022) beträgt 30 % der errechneten gesamten Energiemehrkosten. Die Förderung für die Phase 2 (Kalenderjahr 2023) beträgt 50 % der errechneten gesamten Energiemehrkosten Die Summe der Förderungen je begünstigte Organisation für die Phasen 1 (Kalenderjahr 2022) und 2 (Kalenderjahr 2023) beträgt maximal € 500 000,00. Beträgt die Summe in einer Förderphase weniger als € 800,00, wird keine Förderung ausbezahlt. Ein Zuschuss, der € 15.000,00 nicht übersteigt, wird um € 500,00 erhöht, um die Kosten der Antragsstellung teilweise zu ersetzen. Die Abwicklung der Förderung erfolgt über eine von der AWS einzurichtende elektronische Plattform. Für die Phase 1 ist bis zum 30. Juni 2024 ein Antrag zu stellen und für die Phase 2 bis zum 31. Dezember 2024. Es sind diverse Auflagen sowie Einsichts- und Kontrollrechte und Aufbewahrungspflichten normiert und eine Reihe von Sachverhalten angegeben, wenn die Förderung zurückzuzahlen ist. Diese Informationen sind am Stand 21.1.2024. Änderungen sind möglich. Dieser Artikel umfasst nur einige (unvollständige) Eckpunkte. Für die Beantragung der Förderung sind alle Regelungen der Richtlinie zu beachten. Weitere und aktuelle Informationen, die entsprechende Richtlinie und häufige Fragen und Antworten finden Sie unter https://www.ekz-npo.at/. Stand: 28. Januar 2024 Arbeitnehmerveranlagung 2023: Wie kann man Steuern sparen?
Die Arbeitnehmerveranlagung für 2023 kann bereits beim Finanzamt eingereicht werden. Sollten Sie keine Veranlagung für 2023 einreichen und dennoch eine Steuergutschrift bestehen, so führt die Finanz unter bestimmten Voraussetzungen eine automatische (antragslose) Arbeitnehmerveranlagung durch. Dieser Artikel soll Ihnen einige Tipps geben, wie Sie als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer Geld vom Finanzamt zurückbekommen. Überprüfen Sie Ihre Zahlungen des Jahres 2023, ob die Ausgaben als Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden können. Zu den Werbungskosten zählen zum Beispiel Aus- und Fortbildungskosten, aber auch Umschulungsmaßnahmen und Fahrt- und Reisekosten. Um hier einen Steuervorteil erzielen zu können, sollten die Werbungskosten € 132,00 übersteigen, da ein Werbungskostenpauschale in dieser Höhe bei der laufenden Lohnverrechnung bereits berücksichtigt wird. Bestimmte Berufsgruppen können ein deutlich höheres Werbungskostenpauschale geltend machen. Für Pendlerinnen und Pendler ist das Pendlerpauschale unter bestimmten Voraussetzungen absetzbar. Arbeitnehmer können unter anderem auch Ausgaben für die ergonomische Einrichtung ihres häuslichen Arbeitsplatzes außerhalb eines steuerlich zu berücksichtigenden Arbeitszimmers bis zu einem Betrag von € 300,00 pro Kalenderjahr ohne Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale steuerlich geltend machen. Voraussetzung dafür ist, dass zumindest 26 Tage im Jahr ausschließlich zu Hause (im Homeoffice) gearbeitet wurde. Wird beim steuerfreien Homeoffice-Pauschale durch den Arbeitgeber der Höchstbetrag von drei Euro pro Tag (max. 100 Tage) nicht ausgeschöpft, kann der Arbeitnehmer Werbungskosten (sog. Differenzwerbungskosten) in der entsprechenden Höhe ohne Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale geltend machen (sofern kein steuerlich zu berücksichtigendes Arbeitszimmer vorliegt). Als Sonderausgaben sind beispielsweise bestimmte Spenden, Steuerberatungskosten, Kirchenbeiträge (bis € 400,00 jährlich) und Nachkäufe von Pensionsversicherungsmonaten absetzbar. Bestimmte Sonderausgaben (z. B. Spenden und der Kirchenbeitrag) werden von den empfangenden Organisationen bereits direkt an die Finanz übermittelt. Auch Ausgaben für die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden oder den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungssystem können unter bestimmten Voraussetzungen in Form von Pauschalbeträgen als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Außergewöhnliche Belastungen sind nicht alltägliche Belastungen, die zwangsläufig entstehen. Hier ist auch oft ein einkommensabhängiger Selbstbehalt zu berücksichtigen. Aber auch Katastrophenschäden, Krankheitskosten und Pflegekosten können beispielsweise außergewöhnliche Belastungen sein. Bei einer Behinderung können unter anderem pauschale Freibeträge geltend gemacht werden. Auch Aufwendungen für eine Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des Wohnortes können mit einem Pauschalbetrag als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Absetzbeträge kürzen die zu bezahlende Steuer. Beispiele für Absetzbeträge, die grundsätzlich bei der monatlichen Abrechnung bereits berücksichtigt werden, sind der Verkehrsabsetzbetrag für Arbeitnehmer oder der Pensionistenabsetzbetrag für Pensionistinnen und Pensionisten. Alleinverdienende / Alleinerziehende können unter bestimmten Voraussetzungen in der Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2023 einen Absetzbetrag in Höhe von € 520,00 pro Jahr, bei einem Kind (€ 704,00 bei zwei Kindern, € 936,00 bei drei Kindern und für jedes weitere Kind € 232,00) geltend machen. Bei Unterhaltsleistungen kann ein Unterhaltsabsetzbetrag zustehen. Der Familienbonus Plus ist ein Absetzbetrag in Höhe von € 166,68 pro Monat und Kind bis zu einem Alter von 18 Jahren bei Anspruch auf Familienbeihilfe. Wird für volljährige Kinder die Familienbeihilfe bezogen, so besteht Anspruch auf einen Absetzbetrag in Höhe von € 54,18 pro Monat und Kind. Auch für Arbeitnehmer, die keine Lohnsteuer, sondern nur Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, kann es sinnvoll sein, eine Veranlagung durchzuführen, da ein Teil der SV-Beiträge und auch der Alleinverdienerabsetzbetrag rückerstattet werden kann (Negativsteuer). Auch können Personen mit nur geringem oder keinem Einkommen unter bestimmten Voraussetzungen 2023 einen Kindermehrbetrag von bis zu € 550,00 pro Kind erhalten. Stand: 28. Januar 2024 Wie ist die neue Steuerbefreiung für die Tätigkeit von Freiwilligen geregelt?
Mit dem Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 wurde ab 2024 eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für Zahlungen von gemeinnützigen Organisationen an ihre Freiwilligen geschaffen. Einnahmen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit bis zu € 30,00 Euro pro Kalendertag, höchstens aber € 1.000,00 im Kalenderjahr (kleines Freiwilligenpauschale), sind unter folgenden Voraussetzungen steuerfrei:
Abweichend von den Regelungen zum kleinen Freiwilligenpauschale beträgt das höchstmögliche Freiwilligenpauschale der bzw. des ehrenamtlich Tätigen € 50,00 pro Kalendertag, höchstens aber € 3.000,00 im Kalenderjahr (großes Freiwilligenpauschale), für Tage, an denen sie/er Tätigkeiten ausübt, die
Werden in einem Kalenderjahr sowohl Tätigkeiten entsprechend dem kleinen als auch dem großen Freiwilligenpauschale ausgeübt, können insgesamt nicht mehr als € 3.000,00 im Kalenderjahr steuerfrei bezogen werden. Werden die Höchstgrenzen überschritten, liegen insoweit sonstige Einkünfte im Sinne des EStG vor. Die Körperschaft hat über die Auszahlungen an ehrenamtlich Tätige Aufzeichnungen zu führen und hat unter bestimmten Voraussetzungen Daten der Auszahlungen für jeden ehrenamtlich Tätigen bis Ende Februar des Folgejahres an das Finanzamt zu übermitteln. Stand: 28. Januar 2024 Ausweitung der Spendenbegünstigung durch das Gemeinnützigkeitsreformgesetz
Am 14.12.2023 wurde vom Nationalrat das „Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023“ beschlossen, durch welches die Spendenabsetzbarkeit auf weitere begünstigte Einrichtungen ausgeweitet und das Verfahren zur Erlangung der steuerlichen Spendenbegünstigung deutlich vereinfacht werden sollen. Das Inkrafttreten erfolgte mit 1.1.2024. Ausweitung der BegünstigungSpenden können nur dann steuermindernd als Betriebs- bzw. Sonderausgabe abgesetzt werden, wenn diese explizit an eine im Gesetz ausdrücklich genannte Körperschaft (z. B. Universitäten, Museen, Feuerwehren etc.) oder an eine Empfängerin bzw. einen Empfänger (Körperschaft) geleistet werden, die/der einen begünstigten Zweck verfolgt, welcher durch einen finanzamtlichen Spendenbegünstigungsbescheid nachgewiesen wird. Im Hinblick auf die nicht explizit im Gesetz genannten Körperschaften wurde die Spendenabsetzbarkeit durch das Gemeinnützigkeitsreformgesetz im Umfang wesentlich erweitert. So gelten als begünstigte Zwecke nunmehr alle gemeinnützigen Zwecke gemäß § 35 BAO, alle mildtätigen Zwecke gemäß § 37 BAO sowie auch die Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsaufgaben, die Entwicklung der Künste oder Lehraufgaben zur Erwachsenenbildung. Vereinfachung des MeldeverfahrensIm Hinblick auf die Beantragung eines Spendenbegünstigungsbescheids genügt es nunmehr, dass die Körperschaft die allgemeinen Voraussetzungen gemeinnütziger / mildtätiger Körperschaften erfüllt und seit mindestens 12 Monaten (vormals 36 Monaten) dem begünstigten Zweck dient sowie innerhalb der letzten zwei Jahre keine Verurteilung wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung oder eines vorsätzlichen Finanzvergehens vorliegt. Anstatt der erforderlichen Wirtschaftsprüferbestätigung ist die bescheidmäßige Zuerkennung der Spendenbegünstigung für kleinere Einrichtungen nunmehr mittels eines elektronischen Formulars zu beantragen, welches vom steuerlichen Vertreter via FinanzOnline an das Finanzamt Österreich zu übermitteln ist (Erstantrag). Nur in jenen Fällen, in denen eine gesetzliche oder satzungsmäßige Pflicht zur Abschlussprüfung vorliegt, ist auch weiterhin eine jährliche Bestätigung der Wirtschaftsprüferin bzw. des Wirtschaftsprüfers erforderlich. Stand: 28. Januar 2024 Besondere Fristen für Unternehmer im Februar
Bis Ende Februar sind unter anderem zusätzlich zu melden:Unternehmerinnen und Unternehmer müssen die Jahreslohnzettel ihrer Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer aus dem Jahr 2023 in elektronischer Form bis Ende Februar 2024 an das Finanzamt melden. Unternehmer müssen auch Zahlungen, die für bestimmte Leistungen (z. B. im Rahmen eines freien Dienstvertrages) außerhalb eines Dienstverhältnisses gezahlt werden, an das Finanzamt melden. Die Zahlungen aus dem Jahr 2023 müssen in elektronischer Form bis Ende Februar 2024 gemeldet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Zahlungen an einen Leistungserbringer von mehr als € 100.000,00 pro Kalenderjahr) müssen Zahlungen ins Ausland bis Ende Februar dem Finanzamt gemeldet werden, wenn die Zahlung für bestimmte Leistungen erfolgte, wie z. B. Leistungen, die nach dem Einkommensteuergesetz unter die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit fallen und im Inland ausgeübt werden, bestimmte Vermittlungsleistungen, und kaufmännische oder technische Beratungen im Inland. Bis Ende Februar sind die Schwerarbeitsmeldungen für das Jahr 2023 zu erstellen. Die Meldung muss dem zuständigen Krankenversicherungsträger grundsätzlich elektronisch mittels ELDA übermittelt werden. Bestimmte Beträge (z. B. Spenden, Kirchenbeiträge) werden automatisch als Sonderausgaben berücksichtigt, wenn die empfangenden Organisationen diese an das Finanzamt melden. Die Meldung für 2023 hat durch die betroffenen Organisationen bis Ende Februar 2024 zu erfolgen. Ein Verein muss für jeden Sportler, Schiedsrichter oder Sportbetreuer, dem er in 2023 für eine nichtselbständige Tätigkeit ausschließlich steuerbegünstigte pauschale Reiseaufwandsentschädigungen (§ 3 Abs. 1 Z 16c EstG) ausbezahlt hat, diese dem Finanzamt bis Ende Februar 2024 übermitteln. Weiters ist im Februar besonders zu beachten:Der signierte Jahresbeleg der Registrierkasse zum Jahresende 2023 ist verpflichtend bis spätestens 15.2.2024 (lt. BMF-Info) zu überprüfen. Dies kann manuell mit der BMF-Belegcheck-App oder automatisiert durch Ihre Registrierkasse durchgeführt werden. Stand: 28. Januar 2024 Wie wurde der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag ab 2024 gesenkt?
Alle Dienstgeberinnen und Dienstgeber, die im Bundesgebiet Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beschäftigen, haben grundsätzlich einen Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) zu leisten. Mitglieder der Kammer der gewerblichen Wirtschaft haben neben dem DB auch einen Zuschlag (DZ) abzuführen. Es handelt sich beim DZ um eine Kammerumlage der Wirtschaftskammer. DB und DZ werden von der Summe der Arbeitslöhne, die in einem Kalendermonat an die Dienstnehmer gewährt werden, berechnet. Die Höhe des DB ist bundesweit gleich und beträgt grundsätzlich 3,9 % der monatlichen Bruttolohnsumme. Ab dem Kalenderjahr 2025 beträgt der DB 3,7 % und auch in den Jahren 2023 und 2024 beträgt der Beitrag 3,7 %, wenn dies in bestimmten lohngestaltenden Vorschriften so festgelegt ist. Die Höhe des DZ ist in den Bundesländern unterschiedlich. Die Prozentsätze haben sich für 2024 wie folgt reduziert:
Für DB/DZ/Kommunalsteuer gilt: Ist die Bemessungsgrundlage in einem Kalendermonat nicht höher als € 1.460,00, verringert sie sich um € 1.095,00. Stand: 28. Januar 2024 Mit Finanzplanung Liquiditätsengpässe aufdecken
Eines der wichtigsten Ziele eines Unternehmens ist es, die Liquidität aufrechtzuerhalten. Wird ein Unternehmen zahlungsunfähig, so liegt ein Insolvenztatbestand vor. Um nicht von Liquiditätsengpässen überrascht zu werden, ist es ratsam, mittels eines Finanzplanes die Zahlungsströme eines Unternehmens zu erfassen und deren Auswirkung auf das Bankkonto zu planen. Kurzfristige Finanzplanung ist dabei im Sinne einer Liquiditätsvorschau auf Tages- oder Wochenbasis nur wenige Wochen in die Zukunft gerichtet. Dies ist besonders bei Unternehmen in der Krise erforderlich, die bereits nur sehr geringe liquide Mittel zur Verfügung haben. Ausgehend von einem Liquiditätsstatus (Stände der Bankkonten) werden die kurzfristig zu erwartenden Aus- und Einzahlungen geplant. Eine mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich oft über ein bis zwei Jahre und kann auch rollierend durchgeführt werden. Geplant wird auf Monats- bzw. eventuell auch auf Quartalsbasis und der Finanzplan wird oft aus den geplanten Budgetzahlen abgeleitet. So können frühzeitig mögliche Liquiditätsengpässe identifiziert werden und in Ruhe Gegenmaßnahmen, wie z. B. Gespräche mit der Bank oder Aufbringung von Eigenkapital diskutiert werden. Die langfristige Finanzplanung hat meist einen Planungshorizont von mehreren Jahren und wird aus einem langfristigen Erfolgsplan abgeleitet. Stand: 28. Januar 2024
A-1130 Wien, Hummelgasse 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|